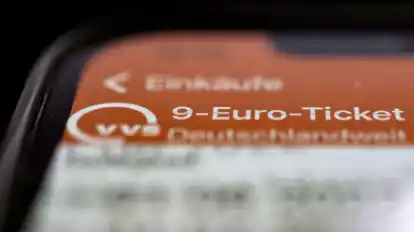Das größte deutsche Verkehrsexperiment neigt sich dem Ende entgegen: Am Mittwoch nächster Woche können Fahrgäste zum letzten Mal für neun Euro an die Ostsee, ins Allgäu oder nach Berlin reisen. Einen Tag später kommen sie mit neun Euro vom Bremer Hauptbahnhof nach Osterholz-Scharmbeck, nicht aber wieder zurück – das Einzelticket kostet 6,25 Euro. Begriffe wie Verbundgrenzen und Anschlusstickets, Streifenkarten und Tarifzonen werden wieder zum Wortschatz der Menschen gehören. Was im Mai noch normal war, fühlt sich jetzt an wie eine Rückkehr in ein anderes Jahrzehnt.
Das Neun-Euro-Ticket sei „eine der besten Ideen, die wir hatten“, bilanzierte Bundeskanzler Olaf Scholz jüngst. Damit hat er recht, aber die logische Konsequenz will Scholz nicht ziehen: Obwohl fast alle Argumente und viele Vorschläge auf dem Tisch liegen, gibt es eine Woche vor Ablauf des Neun-Euro-Tickets noch immer keine Zusage für ein Folgemodell – das ist in mehrfacher Hinsicht unverständlich. Das Neun-Euro-Ticket sollte die Bürger und Bürgerinnen finanziell entlasten. Diese Entlastung wird im Herbst und Winter, wenn die hohen Energiepreise viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen bringen werden, noch wichtiger als bisher sein. Den Bürgern in dieser Zeit weitere Kosten durch eine Rückkehr zum teuren Nahverkehr aufzubürden, würde die Effekte des Neun-Euro-Tickets verpuffen lassen.
Die Erfahrungen aus diesem Sommer zu ignorieren, wäre außerdem ein gefährliches Signal. Der kostengünstige ÖPNV ist nicht nur von der Bevölkerung gewünscht, sondern auch unbestreitbar Voraussetzung für eine Verkehrswende. Und ja: Die Verkehrswende wird viel Geld kosten, wie auch das Neun-Euro-Ticket viel Geld gekostet hat. Wenn Finanzminister Christian Linder sagt, das Neun-Euro-Ticket lasse sich nicht weiter finanzieren, ohne an anderen Stellen zu sparen, hat er recht. Dass er dabei im ARD-Sommerinterview den Bildungssektor als Beispiel nannte, ist ein billiger Versuch, zwei finanziell prekäre Bereiche gegeneinander auszuspielen. Es gibt mit der Einführung einer Übergewinnsteuer und der Abschaffung des Dieselprivilegs konkrete und sinnvolle Vorschläge, wie man einen Nachfolger des Neun-Euro-Tickets umweltfreundlich und sozial gerecht finanzieren könnte.
Ein eigentlich vernünftig scheinendes Argument gegen subventionierte ÖPNV-Tickets wirkt auf den zweiten Blick besonders absurd. Sollte man das Geld nicht lieber in den Ausbau der Infrastruktur stecken? Immerhin hätten, wie auch Scholz zuletzt betonte, die vergangenen Monate Schwierigkeiten und Defizite im Nahverkehr aufgedeckt. Erstens stimmt das nur teilweise: Wer regelmäßig mit Regionalzügen unterwegs ist, kennt sich seit Jahren mit Verspätungen, Ausfällen und anderen Ärgernissen aus. Zweitens läuft das Argument doch letztendlich darauf hinaus: Der Kunde soll jetzt zu viel Geld für zu wenig Leistung bezahlen, um möglicherweise irgendwann eine angemessene Leistung zu erhalten. Wäre es da nicht zumindest vorläufig sinnvoller und fairer, für wenig Leistung wenig Geld zu bezahlen? Klar ist ohnehin, dass der lange vernachlässigte und unbedingt notwendige Infrastrukturausbau so teuer wird, dass er nicht allein durch Ticket- und Aboerlöse finanzierbar ist.
Mobilität ist auch eine soziale Frage
Dass in den vergangenen drei Monaten weniger Pendler vom Auto auf die Bahn umgestiegen sind als gehofft, ist schade, aber auch verständlich – kaum jemand wird sein Auto abschaffen, wenn die Alternative ein festes Ablaufdatum hat. Auch wenn manche Kritiker diesen Eindruck erwecken: Diejenigen, die den ÖPNV in der Freizeit genutzt haben, sind keine Fahrgäste zweiter Klasse. Ihre zusätzlichen Fahrten, die es ohne das Neun-Euro-Ticket nicht gegeben hätte, helfen nicht dem Klima und bringen die Verkehrswende eher indirekt voran.
Mobilität ist aber auch eine soziale Frage – mobil zu sein heißt, am Leben teilzunehmen. Auch das sollten alle Verantwortlichen bedenken, wenn sie in den nächsten Tagen ihre Lehren aus dem größten deutschen Verkehrsexperiment ziehen.