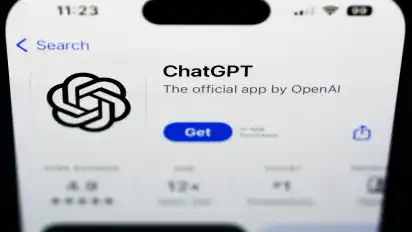Das Jahr 2023 hat zahlreiche Veränderungen durch die Digitalisierung mit sich gebracht – und das sowohl im Positiven wie im Negativen. Spätestens seit Beginn dieses Jahres ist das Thema der künstlichen Intelligenz in aller Munde, denn die erheblichen Fortschritte der sogenannten generativen KI – darunter fallen das viel zitierte Chat-GPT, aber auch Bard von Google, Copilot oder LLaMA – haben unser Leben auf den Kopf gestellt.
Viele dieser Tools ermöglichen ungeahnte Kreativität, erleichtern und beschleunigen unsere Arbeit oder helfen uns auskunftsfreudig dort weiter, wo wir selbst nicht mehr weiterwissen. Doch mit der Allgegenwärtigkeit der künstlichen Intelligenz gehen auch bislang ungeahnte Risiken einher: Menschen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, die Cyberrisiken im Netz sind gestiegen, in Zeiten von globalen politischen Spannungen wird KI gezielt zu Desinformation eingesetzt. Und wenn Studierende Hausarbeiten schreiben, können Hochschullehrer die echte gedankliche Leistung kaum noch von einem Ergebnis der KI unterscheiden.
Gesetzgeber in der Pflicht
Mit all den erkannten Risiken ist auch der europäische Gesetzgeber auf den Plan gerufen, den negativen Entwicklungen bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz zu begegnen. Noch vor wenigen Tagen hat sich die EU deshalb politisch auf einen neuen KI-Rechtsakt geeinigt, der die Technologie künftig in verschiedene Risikoklassen unterteilen wird, um ihre Nutzung mit dem gesellschaftlichen Gemeinwohl besser in Einklang zu bringen. Doch wie bei jeder gesetzlichen Regulierung wird auch der EU „AI Act“ nur der technischen Entwicklung folgen und so kann schon jetzt auch für 2024 prognostiziert werden, dass uns in der künstlichen Intelligenz mit Sicherheit noch zahlreiche weitere Herausforderungen erwarten werden.
Auch der Datenschutz war in diesem Jahr wieder ein großes Thema. Gleich zu Beginn des Jahres gab es im Netz kursierende Gerüchte über sogenannte Abmahnanwälte, die ahnungslose Website-Betreiber wegen angeblichen Datenschutzverletzungen mit pauschalen Schadensersatzforderungen überhäuften und dabei auf den Zahlungswillen bei einem eingehenden Anwaltsschreiben vertrauten. Mittlerweile hat sich die Abmahnwelle zwar weitestgehend erledigt – einerseits deshalb, weil zwischenzeitlich auch Webtools aus den USA, um die es damals ging, im Wesentlichen datenschutzkonform eingesetzt werden können. Andererseits aber auch, weil einige ebenjener Abmahnanwälte strafrechtlich verurteilt wurden. Auch der "Enkeltrick 2.0“ zählt zu den immer ausgefeilteren Betrugstechniken im Netz. Dabei machen sich Cyberkriminelle moderne Technik zunutze, um sich als legitime Zahlungsempfänger auszugeben.
Spionage über Apps aus dem Ausland?
Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Jahr waren digitale Anwendungen aus dem Ausland. Im März lief auch in Deutschland eine Debatte über ein mögliches Verbot der Social-Media-App Tiktok, nachdem insbesondere aus den USA ein Spionageverdacht für die chinesische Software geäußert wurde. Jetzt, im Dezember, hat es weder ein flächendeckendes Tiktok-Verbot gegeben noch hat sich der Spionage-Verdacht belastbar erhärtet. Klar ist aber allen geworden: Beim Teilen seiner persönlichen Daten im Netz und vor allem in den sozialen Netzwerken muss man mittlerweile vorsichtiger denn je sein, um dem Datenmissbrauch vorzubeugen.
Erfreuliche Entwicklungen hingegen hat es im Bereich der virtuellen Realität gegeben – der nächste große Technologiesprung nach der künstlichen Intelligenz, der sich zurzeit anbahnt. Schon die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es sein kann, dass wir uns virtuell treffen und austauschen. Was im Moment noch recht wenig authentisch über Videokonferenzen funktioniert, könnte in einigen Jahren so weit sein, dass die Technologie reale Treffen zu erheblichen Teilen ersetzt und so gerade im Beruf Zeit spart und Ressourcen schont.