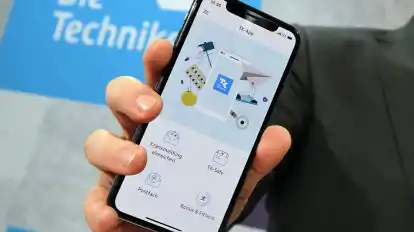Arztbriefe, Medikationspläne, Laborbefunde, Röntgenbilder, Impfausweis oder Mutterpass – all dies gesammelt an einem Ort: Das ist die elektronische Patientenakte (ePA). Man kann sie sich als digitalen, lebenslangen Aktenordner für Gesundheitsdaten vorstellen, teilt die Verbraucherzentrale Bremen mit. Vom 1. Januar 2025 an sollen die gesetzlichen Krankenkassen für jeden Versicherten eine solche digitale Akte anlegen.
Was bedeutet die "elektronische Patientenakte für alle" – wird sie zur Pflicht für Versicherte?
"Seit Januar 2021 können gesetzlich Krankenversicherte eine elektronische Patientenakte bei ihrer Krankenkasse beantragen – bislang wird dies aber nur von etwa einem Prozent der Versicherten genutzt", teilt die Kassenärztliche Vereinigung Bremen mit. Ab Januar 2025 werde die digitale Akte daher neu aufgelegt, als „ePA für alle“. Wichtig dabei: "Die Nutzung der ePA bleibt auch weiterhin freiwillig. Wer sie nicht nutzen möchte, kann der Einrichtung widersprechen", betont die Verbraucherzentrale Bremen.
Wie wird die digitale Akte genutzt?
Laut der Verbraucherzentrale dient sie als persönlicher, digitaler und lebenslanger Aktenordner für Gesundheitsdaten. "Ärzte, Krankenhäuser, Physiotherapeuten und andere medizinische Einrichtungen stellen medizinische Unterlagen ein, sofern Sie dem nicht widersprochen haben. Auch Sie selbst können dort Gesundheitsdaten einspeichern."
Was sind die Vorteile?
Die elektronische Patientenakte soll unter anderem Arztwechsel einfacher machen oder den Austausch von Dokumenten zwischen Arztpraxen, Apotheken und Kliniken erleichtern. "Bei einem Krankenhausaufenthalt liegen Ihre Gesundheitsdaten vor, wenn Sie dem Zugriff des Krankenhauses nicht widersprechen", nennt die Verbraucherzentrale als Beispiel. Oder: Ärzte hätten einen besseren Überblick, sodass etwa unnötige Doppeluntersuchungen entfielen. Und: Im Notfall lägen alle wichtigen Informationen gesammelt und schnell vor.
Was sind die Nachteile?
"Trotz hoher Sicherheitsstandards könnte es zu Datenlecks und Cyberangriffen kommen. Das kann man nie ausschließen. Sensible Gesundheitsdaten könnten in falsche Hände geraten", sagen die Bremer Verbraucherschützer. Der Zugang zur elektronischen Akte könne zudem durch Systemausfälle, technische Fehler oder eine langsame Internetverbindung erschwert sein. "Die ePA braucht eine stabile technische Infrastruktur." Hinzu komme: Menschen ohne geeignetes Endgerät wie etwa Laptop oder Tablet hätten keinen eigenständigen Zugriff, seien also auf andere mit entsprechenden Geräten angewiesen. Nicht alle Patienten seien zudem hinreichend technisch versiert.
Gibt es die ePA auch für Privatpatienten?
"Auch privat Versicherte können eine elektronische Patientenakte nutzen, wenn ihre private Krankenversicherung die Möglichkeit einer ePA bietet. Hierzu gibt es aber keine Verpflichtung", heißt es von der Bremer Verbraucherzentrale.
Wie erhält man die elektronische Akte – und wie widerspricht man?
Vom 15. Januar 2025 an wird die ePA automatisch von der Krankenkasse, bei der man versichert ist, eingerichtet. Die Kasse informiert ihre Versicherten darüber vorab. Falls man nicht möchte, dass eine digitale Akte bereitgestellt wird, kann man dies laut der Verbraucherzentrale der Kasse mitteilen und widersprechen. Auch wenn die Frist verstrichen sei oder man später seine Meinung ändert, ist nach Angaben der Verbraucherschützer ein Widerspruch möglich. Dann lösche die Krankenkasse die bereits erstellte ePA mit allen Daten.
"Alle gesetzlich Versicherten haben einen Anspruch auf eine ePA. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Einen möglichen Widerspruch erklärt in diesem Fall der gesetzliche Vertreter, also in der Regel die Eltern. Ab Vollendung des 15. Lebensjahrs können Jugendliche ihre Widerspruchsrechte auch selber ausüben", teilt das Bundesgesundheitsministerium in einem Frage-Antwort-Katalog auf seiner Internetseite mit.
Welche technischen Voraussetzungen sind erforderlich?
Jede Krankenkasse bietet ihre eigene ePA-App an. Unter welchem Namen man die jeweilige Anwendung zum Download findet, zeigt eine Online-Liste der Gematik, der nationalen Agentur für digitale Medizin. Damit die ePA-App auf dem Gerät auch läuft, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Notwendig ist nach Angaben der Verbraucherzentrale dafür entweder ein Smartphone oder Tablet mit einem Betriebssystem ab Android 9 oder ab iOS 16. Die ePA-App lässt sich auch am Desktop-PC oder Laptop nutzen, wenn ein Kartenlesegerät ab Sicherheitsklasse 2 mit eigener Tastatur vorliegt.
Ist die App heruntergeladen, müssen Versicherte sie zunächst freischalten, bevor sie sie nutzen können. Dafür müssen sie ein Identifikations- und Anmeldeverfahren durchlaufen, das von Kasse zu Kasse unterschiedlich sein kann. Für diese Registrierung und Anmeldung ist nach Angaben der Verbraucherzentrale eine NFC-fähige Gesundheitskarte und die dazugehörige PIN oder eine Gesundheits-ID notwendig. Eine NFC-fähige Gesundheitskarte erkennt man am Kontaktlos-Logo und an der sechsstelligen sogenannten CAN-Nummer unter den Deutschlandfarben. Wer noch eine alte Karte ohne diese Funktion hat, kann bei der Krankenkasse eine neue anfordern.
Wie funktioniert die elektronische Patientenakte im Alltag und wer hat Zugriff auf die Daten?
Geht man in die Arztpraxis, kann man nun darum bitten, dass aktuelle Befunde, Arztbriefe oder Laborwerte oder auch ältere Dokumente in der ePA abgelegt werden. Auch Mutterpass, Impfausweis und Zahnbonusheft können dort in digitaler Form gespeichert werden. Die ePA lässt sich auch von Patient oder Patientin selbst befüllen. Arztbriefe, die man nur auf Papier hat, kann man einscannen und hochladen. Und: Man kann in der App festlegen, ob man bestimmten Arztpraxen, Krankenhäusern oder auch Apotheken jeweils Zugriff auf bestimmte Dokumente der ePA gewähren möchte, teilt die Gematik mit.
Dabei lässt sich auch einstellen, dass die Berechtigung nur für eine bestimmte Zeitspanne gelten soll – etwa ausschließlich für den Tag, an dem man den Arzttermin hat, heißt es von der Verbraucherzentrale. "Sie als Inhaber der elektronischen Patientenakte haben alle Rechte. Sie entscheiden, wer auf die Akte zugreifen kann und erteilen hierfür Berechtigungen. Sie können jederzeit Inhalte einsehen, einfügen, löschen oder verbergen, Zugriffsrechte erteilen oder beschränken und Widersprüche einlegen." Welche Leistungserbringer die Akte einsehen, lesen und Daten einspeichern könnten, sei gesetzlich festgelegt.