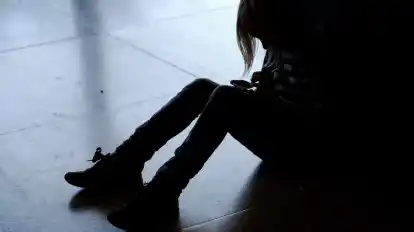Als Schwester eines psychisch Kranken ist sie „eine von Millionen“. Das stellt die Autorin und Psychologin Jana Hauschild fest. Denn acht von zehn Menschen haben Geschwister. Wenn man ausrechnet, wie viele Menschen psychisch erkrankt sind, komme man zu der Zahl in Millionenhöhe. Sie selbst gehört dazu. Ihr sechs Jahre älterer Bruder leidet an der Borderline-Persönlichkeitsstörung. So kam es, dass Hauschild im Alter von zwölf Jahren erfuhr, dass sich ihr geliebter Bruder umbringen wollte. In ihrem Buch „Übersehene Geschwister“ schreibt sie darüber, wie die Krankheit ihr Leben beeinflusst hat. Und obwohl es so viele Menschen wie sie gibt: Sie ist der Meinung, dass die Gesellschaft sie übersieht. „Zugleich nehmen die meisten Geschwister zur Entlastung der Eltern intuitiv einen Platz im Hintergrund ein, halten sich bedeckt, wollen keine weiteren Ressourcen aufbrauchen. Sie sind Schattenkinder.“
Der Begriff Schattenkinder wird häufig verwendet, wenn es um die Geschwister von chronisch kranken sowie behinderten Kindern geht. Schattenkinder bekommen weniger Aufmerksamkeit von den Eltern und müssen öfter zurückstecken, heißt es. Gleichzeitig geht ihnen das Leid des anderen nahe, wie Jana Hauschild weiß. Vor allem, weil die Erkrankungen meist in einer Zeit ausbrechen, in der sie selbst in der Entwicklungsphase sind.
Wenn zwei Kinder gesund sind und ein Kind unter einer Behinderung leidet
Die Münchener Autorin Ilse Achilles hat sich mit den Familien behinderter Kinder auseinandergesetzt. Dabei spricht sie auch aus eigener Erfahrung: Sie hat zwei gesunde Töchter und einen behinderten Sohn. Achilles ist sich sicher, dass es für die gesunden Kinder wichtig ist, sich im Umgang mit ihrem Geschwisterteil zu distanzieren. „Denn diese Distanz und den Mut zu einem speziellen Egoismus brauchen sie unbedingt, um ihr eigenes Leben erfolgreich zu führen.“
In ihrem Buch „…und um mich kümmert sich keiner!“ schildert Achilles Beobachtungen aus ihrem Alltag. Sie blickt etwa auf eine Situation mit dem fünfjährigen Markus zurück, dessen Bruder Autismus hat. „Für Daniel machen sie immer alles. Für mich nichts. Um mich kümmert sich niemand!“, sagte Markus eines Tages. Der Auslöser für den Wutanfall war, dass die Eltern das Haus bereits abgeschlossen hatten, Markus aber die Frisbeescheibe holen wollte. Seine Eltern reagierten genervt. „Ich kann mir inzwischen vorstellen, wie groß die Verzweiflung, die Zurücksetzung, die Schmerzen, Zweifel und Ängste sind, die der junge Markus bewältigen muss“, schreibt die Autorin.
Im Gespräch mit Geschwistern behinderter Kinder stellte Achilles fest, dass sie extrem belastet sind – auch wenn sie es selbst nicht so empfinden. Die Eltern erwarten einiges von ihnen: das übliche Helfen im Haushalt, gute Schulnoten sowie einen Einsatz, der fast einer pflegerischen oder heilpädagogischen Ausbildung bedarf. „Wir müssen Sophie stützen und tragen“, sagt etwa Jessica. Alle Kinder sagen, dass sie den Eindruck haben, dass das behinderte Geschwisterteil vorgezogen wird. „Ich komme immer erst zum Schluss dran. Manchmal möchte ich sagen: Mutti, ich bin auch noch da. Aber das mach‘ ich nicht“, äußert die junge Anne-Marie.
Geschwisterberatung bei der Lebenshilfe Bremen
Ein Beratungsangebot der Lebenshilfe Bremen nimmt die Geschwister in den Mittelpunkt. Die Familientherapeutin Lisbeth Suhrcke führt die Gespräche durch. „Meist fragen Eltern eine Beratung an“, sagt sie. Diese Gespräche verlaufen ganz unterschiedlich, je nachdem, ob die Eltern eine konkrete Frage mitbringen, sich informieren wollen oder von anderer Stelle geschickt wurden. „Ich versuche erst mal herauszufinden, was die Eltern bewegt, welche Sorgen und Ängste sie vielleicht haben und wozu sie die Beratung nutzen wollen.“ In einer nächsten Sitzung lernt sie die Kinder kennen. Während den Eltern oft wenige Treffen reichten, wollten viele Kinder öfter kommen. „Sie scheinen die exklusive Zeit nur für sich sehr zu genießen.“
Jüngere Kinder haben meist keine konkreten Fragen, wie die Therapeutin beobachtet. Im Spiel oder Gespräch kristallisierten sich aber Themen heraus. „Ich versuche die Geschwisterkinder als ganz individuell und besonders wahrzunehmen und darin zu stärken, was und wie sie sind.“ Über das kranke Geschwisterteil sprechen sie weniger, da sie meist ohnehin im Fokus der Familie stünden. Bei erwachsenen Geschwistern sehe die Situation anders aus. Manche befinden sich etwa in einem Konflikt – sie sind hin- und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber dem behinderten Geschwisterteil und der eigenen Lebensplanung. Wenn die Eltern älter werden, stehe nämlich die Frage im Raum, wie es nun mit der Betreuung weitergehe. „Kann und will ich die übernehmen? Das Pflichtgefühl ist da oft sehr hoch“, sagt Lisbeth Suhrcke. Sie hilft dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.
Die Botschaft an die Eltern: "Ihr macht alles richtig"
Den Eltern will die Therapeutin vermitteln, dass sie alles richtig machen. Denn Eltern hätten ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Kinder. Im Alltag sei vieles nur nicht immer umsetzbar. Dann meldet sich aber das schlechte Gewissen. „Manchmal hilft es dann, das auszusprechen oder eine Einschätzung von außen zu hören“, sagt Suhrcke. Die Eltern sollten zudem nie vergessen: Sie müssen sich auch um sich selbst kümmern, um überhaupt Kraft für ihre besondere Familie zu haben. Das Angebot der Geschwisterberatung ist freiwillig und kostenlos, da es durch Spenden finanziert wird. Beim Klönschnack können sich einmal im Monat erwachsene Geschwister austauschen. Weitere Infos gibt es auf der Seite www.lebenshilfe-bremen.de/geschwister.
Bei einem solchen Treffen für erwachsene Geschwister in Tübingen hat Naomi zum ersten Mal wirklich verstanden, warum sie so ist, wie sie ist. Davon berichtet sie in Dunja Batarilos Podcast „Für immer anders. Der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung“. Damals war Naomi 22 Jahre alt, heute 28. Sie begriff, dass sie nicht einfach „komisch“ ist – sondern dass die Wurzeln ihrer Selbstwertprobleme in ihrer einsamen Kindheit liegen. Denn während sich ihre Eltern um den schwerst- und mehrfachbehinderten Bruder kümmerten, musste sie sich andere Bezugspersonen suchen. So begab sie sich in manipulative Freundschaften und Partnerschaften. Für Naomi war es sehr schön zu merken, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen ist – und dass nicht sie das Problem ist. „Sondern das sind Strukturen, das sind Verhaltensweisen und es ist normal, dass ich mich dementsprechend entwickelt habe.“