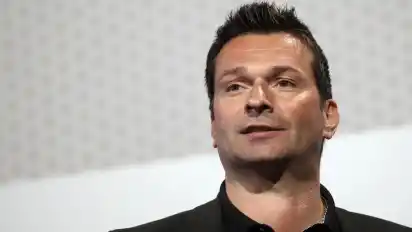Für Christian Heidel war der Montag vor einer Woche ein guter Tag. Da nämlich konnte der umtriebige Manager des FSV Mainz 05 auf der Mitgliederversammlung Rekordzahlen verkünden: 78,7 Millionen Euro hatte der Fußball-Bundesligist im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzt und dabei einen Gewinn von fast exakt fünf Millionen Euro gemacht. Der Etat für die Bundesliga-Mannschaft ist ähnlich hoch wie bei Werder Bremen (29 zu 30 Millionen). Mainz schafft das, weitere Parallele zu Werder, ohne strategischen Partner.
In Mainz soll das auch in Zukunft so bleiben. „Einen strategischen Partner wird es mit uns nicht geben“, versicherte 05-Präsident Harald Strutz den Vereinsmitgliedern gerade erst. Allein mit Bordmitteln versuchen es in der Bundesliga aber nur noch wenige Klubs. Außer Werder sucht noch der 1. FC Köln nach Partnern, auch der VfB Stuttgart will sich öffnen. Andere sind da schon weiter: Hertha BSC etwa hat einen Investor gefunden, Eintracht Frankfurt hat rund ein Drittel seiner Profiabteilung verkauft, Hannover 96 sogar über 80 Prozent. Der HSV schließlich behilft sich im Moment mit dem Mäzen Klaus-Michael Kühne, der 20 Millionen Euro als Kredit zur Verfügung gestellt hat und demnächst Anteile an der kürzlich ausgegliederten Profiabteilung erwerben wird.
Klubs wie der FC Bayern, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 spielen als dauerhafte Champions-League-Teilnehmer sowieso in einer ganz eigenen Liga. Die Bayern arbeiten mit strategischen Partnern wie Audi, Adidas und Allianz, die rund ein Viertel an der FC Bayern Fußball-AG halten und dafür zusammen fast 300 Millionen Euro gezahlt haben. Borussia Dortmund hat als einziger börsennotierter Bundesligist gerade erst eine neue Kapitalerhöhung vorgenommen und damit 114 Millionen Euro frisch zur Verfügung. Schalke 04 lebt von den Gazprom-Millionen sehr gut.
Eine zweite Gruppe bilden die von Konzernen oder Unternehmern alimentierten Klubs wie VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen oder der künftige Erstligist RB Leipzig, bei denen, salopp formuliert, Geld keine Rolle spielt, weil es die Bayer AG (Leverkusen), SAP-Gründer Dietmar Hopp (Hoffenheim), VW (Wolfsburg) und Red Bull (Leipzig) gibt.
Andernorts muss man kreativer sein, etwa in Mainz. Wie haben die das dort bloß hingekriegt? Die Mainzer verlassen sich auf ihr kaufmännisches, fachliches und sportliches Geschick. Und sie spielen seit 2011 in einem neuen, modernen und vor allem vergrößerten Stadion, das Mehreinnahmen beim Ticketverkauf sichert. Toptrainer wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben aus beschränkten Möglichkeiten im sportlichen Bereich das Optimum herausgeholt. Schließlich hat Mainz mit einer klugen Transferpolitik und Verkäufen von Profis wie André Schürrle, Adam Szalai oder Nicolai Müller viele Millionen verdient. Diese Komponenten fügen sich zu einem Erfolgsmodell.
Erstaunlich sind die Parallelen zu Borussia Mönchengladbach. Auch dort gibt es seit einigen Jahren ein modernes, großes Stadion, auch die Gladbacher haben viel Geld durch die Verkäufe von Spielern wie Marc-Andre ter Stegen, Marco Reus und Dante eingenommen. Wie in Mainz arbeitet in Gladbach ein starkes Management mit einem ausgezeichneten Trainer zusammen. Gladbachs Tuchel heißt Lucien Favre, Gladbachs Heidel heißt Max Eberl. Die Borussia ist schuldenfrei, und der Stammverein e.V. hält 100 Prozent an der Fußball-GmbH. Für den Fall der Fälle hätten die Gladbacher also noch jene Möglichkeiten, die Werder Bremen gerade anfängt, auszuloten.
Frisches Geld: So machen es die anderen Klubs der Liga
◼ Eine Möglichkeit, um Geld von sogenannten strategischen Partnern zu bekommen, besteht darin, Anteile an der Profiabteilung zu verkaufen, die aus dem Gesamtverein ausgegliedert ist.
Der HSV hat diese Möglichkeit gerade erst in diesem Sommer geschaffen. Beim VfB Stuttgart hofft man, ab 2015 so weit zu sein, damit dann Daimler als Partner größer einsteigen kann. Bei Werder ist der Verkauf von Anteilen an der Werder Bremen GmbH&Co. KGaA (aA steht für: auf Aktien) schon möglich.
Bei Eintracht Frankfurt läuft es so: Dort gehören dem e.V., also dem eingetragenen Verein, noch 62,9 Prozent, den Rest haben der Bankier Wolfgang Steubing (3,6 %) erworben, die BHF Bank (5 %) und die sogenannten Freunde der Eintracht, ein Zusammenschluss von vier Banken, (28,5 %).
Bei Hannover 96 sind sieben lokale Gesellschafter an der Fußball-KG beteiligt, darunter Drogerie-Riese Dirk Rossmann, 96-Präsident Martin Kind und der frühere Textil-Unternehmer Detlev Müller („Cecil“, „Street One“). Insgesamt besitzen die sieben lokalen Gesellschafter fast 85 Prozent der Anteile.
Sehr genau verfolgt die Liga, was sich in Berlin abspielt. Die Hertha hat 9,7 Prozent an der Fußball-GmbH an den US-Investor KKR verkauft. Die Seriosität des Partners ist umstritten, Kritiker sprechen von einer „Heuschrecke“. 61,2 Millionen Euro hat Hertha der Deal erbracht. KKR kann bis zu 33,3 Prozent der Anteile erwerben. (mhd)