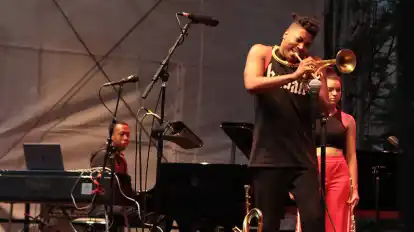Herr Currentzis, Sie vollenden gerade einen Zyklus sämtlicher Beethoven-Symphonien. Wie ist Ihr Bild dieses Komponisten?
Beethoven ist Beethoven, so einfach oder so kompliziert ist das. Er ist kein Klassiker, auch kein Proto-Romantiker. Er gehört keiner Periode an, und die enorme Entwicklung innerhalb seines Werks weist weit über seine Zeit hinaus. Auch mag er revolutionär und politisch gesonnen gewesen sein. Er bildet jedenfalls eine Kategorie für sich.
Eigentlich also ein Monster, für das Sie eine Vorliebe haben?
Zu sagen, man mag Beethoven, wäre so wie wenn man ausdrücken wollte, dass man die ägyptischen Pyramiden gut findet. Das bringt nichts. Allerdings ist zuzugeben: Wenn Musiker untereinander von ihren musikalischen Vorlieben sprechen, ist Beethoven fast nie dabei. Er ist zu groß dafür.
Über Beethoven ist schon furchtbar viel gesagt worden, wenn nicht alles. Oder ist etwas ausgelassen worden, das Sie ergänzen können?
Ich glaube tatsächlich, dass Beethoven Interpretationen braucht. Beethoven versteht sich nicht von selbst. Stattdessen ist er sehr robust und kann allerlei Deutungen aushalten. Ihn zu Ende zu interpretieren, wäre so, wie dem Orakel von Delphi sein Geheimnis zu entreißen. Man lernt bei ihm, wie viel Arbeit es macht, nur vier Noten, so wie am Anfang der 5. Symphonie, in eine melodische Ordnung zu bringen. Und dass alles davon abhängt, wie man diese vier Töne dann endlos variiert. Beethoven ist ein Beispiel dafür, wie Moral die Ästhetik nach sich zieht.
Wie bitte?
Die Aufklärung hatte zur Zeit Beethovens etliche neue Ideale formuliert. Die Moral der Aufklärung bildete eine Art neuer Religion. Das hat eine bestimmte Ästhetik hervorgebracht, um Kunst in den Dienst der neuen Werte zu stellen. Wir leben heute in einer Zeit, wo viele Deutungen einfach Fälschungen sind. Marxistische Deutungen etwa halte ich oft für Fake. Beethoven war zwar mit etlichen seiner Zeitgenossen musikgeschichtlich verbunden, etwa mit Joseph Haydn. In Wirklichkeit überwiegt der eigene Anstoß, den er den Dingen gab. Darin ist er eng mit Bach verwandt. Auch dieser folgte, ästhetisch gesehen, der Moral seiner Zeit. Und hat sich davon nicht im mindesten einengen lassen.
Die Zahl von Beethoven-Aufnahmen ist Legion. Macht das den Fall schwieriger für Sie?
Davon darf man sich nicht irritieren lassen. Es gibt sehr viele Standpunkte. Das fängt schon beim Metronom an. Waren Beethovens Angaben richtig? Hat er sich geirrt?! Ich folge den Metronom-Angaben Beethovens streng, mit ganz wenigen Ausnahmen. In Beethovens Siebter bin ich gelegentlich eine Spur langsamer, im Finale der Fünften etwas schneller. In 99 Prozent der Fälle, glaube ich, stimmen Beethovens Angaben genau. Ich habe ihn früher auch schon einmal doppelt so schnell dirigiert wie heute. Was ich ansonsten tun kann, um eine guten Abend hinzubekommen, ist einfach: Ich muss meinem eigenen Instinkt folgen.
Gehört Beethoven überhaupt zu Ihrem Stamm-Repertoire? Oder sind Sie am Ende überredet worden?
Es hat kein einziges Jahr gegeben, in dem ich keinen Beethoven dirigiert hätte. Er ist mein absolutes Grund-Repertoire. Auch der Zyklus war meine eigene Idee. Wobei ich meiner Schallplattenfirma zugute halten muss, dass man uns zuliebe wie ein Underground-Label funktioniert. Ich habe sie überredet, eine Analog-Version der Siebten auf Vinyl herauszubringen, die separat hergestellt wird und sehr teuer ist. Seit den 80er-Jahren gab es das nicht mehr. Für derlei Verrücktheiten kann ich niemand anderen verantwortlich machen als mich selbst.
Sie werden als musikalischer Extremist beschrieben. Hier ein bisschen schneller als alle anderen, dort ein bisschen langsamer. Mal leiser denn je, mal noch lauter. Mit anderen Worten: Sie übertreiben. Was würden Sie darauf sagen?
Ich würde diese Sichtweise für zu einseitig und für ein bisschen einfältig halten. Ich bin sehr konservativ in Bezug auf Tempi und den Umgang mit dem Notentext. Nur: Wenn da ein Fortissimo steht, muss man es eben auch spielen. In der Vergangenheit, besonders bei Schallplattenaufnahmen, hat man das aber nicht getan, weil man es für nicht wohnzimmertauglich genug hielt. Man wollte den Hörer am Lautsprecher nicht verschrecken. Aber: Musik ist nicht Easy listening. Wir dürfen die Musik nie kastrieren. Es geht um Ehrlichkeit, um nichts sonst. Übrigens neige ich nur in der Musik zur Hyperenergetik. Eigentlich bin ich ganz ruhig.
Was ist ruhig an Ihnen?
Wenn es um mich geht, schreiben die Leute immer gern darüber, was ich für merkwürdige Hosen trage und mit welchen Schuhen ich auf die Bühne komme. Auch meine Haare sind ein beliebtes Thema. Ich will das nicht weiter bewerten, aber in Wirklichkeit ist es so, dass ich in denselben Hosen, in denselben Schuhen und mit derselben Frisur auf die Bühne komme, die man auch außerhalb des Theaters an mir wahrnehmen kann. Ich gehe so auf die Bühne, wie ich bin. Dass das als exzentrisch wahrgenommen wird, finde ich merkwürdig. Im Übrigen: Wenn ich erst einmal damit anfangen würde, im Frack vors Orchester zu treten, müsste ich es immer tun. Das geht mir zu weit.
Was sagt das über Ihre Auffassung von Musik aus?
Es sagt aus, dass ich der Meinung bin, dass es zwischen Bühne und Leben eine absolute Kontinuität geben sollte. Keinen Gegensatz. Kunst ist kein Festtagsball. Ich bin deswegen aber noch lange kein Enfant terrible und kein Punk. Ich bin ein Musiker, der seine Arbeit tut.
Tatsächlich gelten Sie als Arbeitstier. Würden Sie das Arbeitspensum, das Sie für nötig halten, bei einem Orchester wie, sagen wir: den Berliner Philharmonikern überhaupt durchsetzen können?
Das Resultat zählt. Wenn man es mit einem Orchester durch weniger Arbeit erreichen kann, so bin ich auch zufrieden. Musikmachen ist eine spirituelle Sache. Der richtige Geist muss dabei sein. Und dafür braucht man Zeit.
Worin besteht der Geist Ihres Orchesters?
Ich sehe mein Orchester wie eine Familie an. Unsere Proben in Perm sind offen für alle. Die Musiker bringen ihre Kinder mit. Es geht, wie in allen Familien, auf und ab. Aber nur in der Familie fühlt man sich so geborgen, dass man Fehler machen darf. Und genau darauf kommt es an. Ich muss suchen und unsicher sein dürfen. Das wird vielerorts nicht gern gesehen. Weil man es für unentschlossen hält.
In Perm leben Sie auf einem Anwesen mit eigenem Koch und eigenem Masseur. Glauben Sie, dass Sie jemals wieder solche Bedingungen finden werden?
Bedingungen findet man nicht, man schafft sie sich. Auch in Perm habe ich die Dinge nicht erreicht, weil sie mir angeboten wurden, sondern weil ich mir gesagt habe: Nichts darf unmöglich sein, wenn es um Musik sein.
Für viele Instrumentalisten hat ihr Musikinstrument ein bestimmtes Geschlecht. Für die Organistin Iveta Apkalna etwa ist die Orgel männlich, für den Geiger Joshua Bell ist seine Violine weiblich. Welches Geschlecht hat ein Orchester?
Weiblich! Die ganze Welt ist weiblich für mich. Das meine ich nicht unbedingt sexuell. Es betrifft die Energie der Welt.
Ist Musik eine Form des Liebens?
Für mich kann es kein größeres Kompliment geben als wenn man mir sagt: Nach dem Konzert sind wir nach Hause gekommen und haben uns geliebt. Das, und nichts anderes, ist mein höchstes Ziel.
Das Gespräch führte Kai Luehrs-Kaiser.
Teodor Currentzis wurde 1972 in Athen geboren und bezeichnet sich selbst als Exil-Grieche. Nach seinem Studium bei dem St. Petersburger Dirigier-Guru Ilja Musin wurde Currentzis zunächst Chefdirigent in Nowosibirsk, dem größten Opernhaus Sibiriens. Dort gründete er sein Ensemble Musicaeterna, mit dem er 2011 Musikdirektor in Perm wurde.
Weitere Informationen
Teodor Currentzis und Musicaeterna spielen bei der Großen Nachtmusik, der Auftaktveranstaltung des Musikfests Bremen, am 25. August, 19.30 Uhr, in der Glocke. Tickets für die Große Nachtmusik gibt es unter anderem im Pressehaus an der Martinistraße und bei Nordwest-Ticket unter 0421/363636.