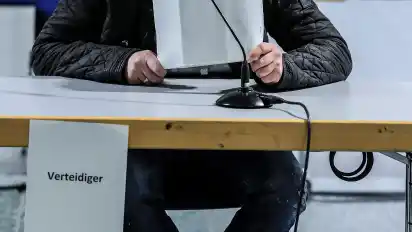Arrestanordnungen über 1,2 Millionen Euro vermeldete in dieser Woche die Staatsanwaltschaft im Zuge von Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Straftätern. Ebenfalls in dieser Woche verurteilte das Landgericht fünf Drogenhändler zu Freiheitsstrafen und ordnete zugleich die Einziehung von insgesamt 3.750.000 Euro an. Hört sich nach guten Nachrichten für das Bremer Stadtsäckel an. Doch was davon letztlich tatsächlich in der Landeskasse landet, ist nicht sicher.
So wurden bei den fünf verurteilten Bremern keineswegs Werte in Höhe 3,75 Millionen Euro sichergestellt. Diese Summe entspricht vielmehr dem Ertrag, den sie bei den Drogengeschäften erlangt haben. Es gilt das Bruttoprinzip, erklärt Silke Noltensmeier-von Osten, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die Regelung, die in derartigen Fällen zum Tragen kommt. Der Einkaufspreis der Drogen wird am Ende nicht vom Tatertrag abgezogen. Nicht der Gewinn, sondern der Verkaufserlös wird abgeschöpft.
Demselben Muster folgt die Arrestanordnung. Im Fall der Verdächtigen, deren Wohnungen in dieser Woche durchsucht wurden, schätzte die Polizei anhand von Chatverläufen und abgehörten Telefonaten, dass die Beschuldigten Drogengeschäfte im Umfang von 1,2 Millionen Euro getätigt haben. Über diese Summe hat die Staatsanwaltschaft als "vorläufige vermögenssichernde Maßnahme" eine Arrestanordnung beantragt, die ein Richter genehmigte. 1,2 Millionen Euro konnten dadurch zwar nicht gesichert werden, aber allein der einfache Tatverdacht reichte, um Bargeld, hochwertige Uhren und Schmuck einkassieren zu können, Bankkonten zu pfänden und zwei Immobilien mit Sicherungshypotheken zu belegen.
Ob diese Werte tatsächlich in die Staatskasse fließen, muss der Gerichtsprozess zeigen. Bis zur Rechtskraft des entsprechenden Urteils bleiben die Werte jedoch gesichert, die mutmaßlichen Täter haben darauf keinen Zugriff mehr. Die Sicherungshypotheken auf den Immobilien sorgen dafür, dass die Besitzer sie nicht vor dem Gerichtsprozess an der Staatsanwaltschaft vorbei verkaufen können. Diese Hypotheken werden erst gelöscht, wenn die vom Gericht eingezogene Summe beglichen wurde. Was nach einer Verurteilung auch bedeuten kann, dass die Immobilien zwangsversteigert werden und der Erlös in die Staatskasse fließt.
In Bremen flossen auf diese Weise in den vergangenen drei Jahren insgesamt 11,3 Millionen Euro endgültig in die Landeskasse. Grundlage dafür war das 2017 reformierte Vermögensabschöpfungsgesetz, das den Ermittlungsbehörden den Zugriff auf das Vermögen von Beschuldigten und überführten Straftätern erleichtert hat. Es ermöglicht unter anderem den Zugriff auf das gesamte Vermögen des Betroffenen und nicht nur auf die Gegenstände, die er vermeintlich rechtswidrig erlangt hat.
Allerdings kennen auch die Straftäter dieses Gesetz – und reagieren darauf mit der Verschleierung ihrer Vermögenswerte. Indem sie diese etwa frühzeitig ins Ausland verschieben oder auf Dritte übertragen; oder indem sie Immobilien und hochwertige Autos über Strohleute erwerben.
Dass es knifflig sein kann, Bargeld und Wertgegenstände zweifelsfrei einem Angeklagten zuzuordnen, zeigte sich jüngst bei dem Prozess am Landgericht gegen fünf Drogenhändler. Einer von ihnen war im September 2020 festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seines Hauses stieß die Polizei in einer Schminktasche auf 24.724 Euro Bargeld. Das Geld gehöre seiner Frau, bekundete der Angeklagte nun vor Gericht mit Verweis auf die Schminktasche. Und er lieferte auch eine Erklärung für die exakte Summe: Im August habe seine Frau ihren Wagen für 17.500 Euro verkauft, außerdem kurz zuvor 7224 Euro Rückgeld für eine wegen Corona ausgefallene Reise von einem Reisebüro zurückerhalten. Und: Die beschlagnahmte Rolex sei eine Damenuhr, gehöre also zweifelsfrei ebenfalls seiner Gattin.