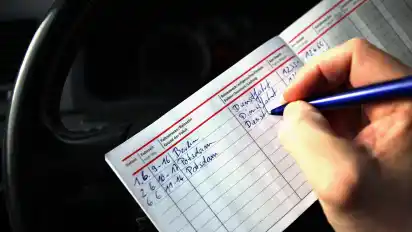Der Fahrer eines Dienstwagens in Deutschland ist in den meisten Fällen männlich. Er arbeitet am häufigsten in einem Unternehmen aus dem Großhandel, der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie oder dem Bauwesen. Ist er eine Führungskraft, ist sein bevorzugtes Dienstauto ein Mercedes, ein BMW oder ein Audi. In der Automobilbranche und im Bankenwesen werden dabei die teuersten Dienstwagen eingesetzt, sie haben einen Bruttolistenpreis von rund 47.000 Euro. Der Dienstwagenmonitor, eine regelmäßige Untersuchung der Unternehmensberatung Compensation Partner aus Hamburg, erklärt dies so: In diesen Branchen sehe man den Dienstwagen „klar als Statement Richtung Kunde“. Will sagen: Der Dienstwagen soll schon etwas hermachen.
Die Strahlkraft von Dienstwagen wirkte jahrzehntelang auch in die andere Richtung: auf die eigenen Mitarbeiter. Wer einen Dienstwagen hat, unterscheidet sich von den Kollegen ohne. Nicht umsonst locken Unternehmen talentierte Mitarbeiter gern mit der Aussicht auf einen eigenen Dienstwagen. Noch 2010 erklärten in einer Emnid-Umfrage mehr als 50 Prozent der Beschäftigten, dass sie gern einen Dienstwagen hätten. Doch die Zeiten haben sich seitdem geändert. Der Dienstwagen als reines Prestigeobjekt scheint langsam auszudienen.
Als erstes großes deutsches Unternehmen hat Siemens kürzlich erklärt, das klassische Dienstwagen-Modell abschaffen zu wollen; zuerst ab 2022 für die leitenden Angestellten, das sind 1500 weltweit, bis 2030 dann für die komplette Fahrzeugflotte, also auch im Service und Vertrieb, die heute 45.000 Autos umfasst. Bis 2030 soll der tägliche Geschäftsbetrieb bei Siemens CO2-neutral sein. Dazu soll auch das neue Dienstwagen-Modell beitragen, das auf umweltfreundlichere Antriebsarten und stärkere Anreize an die Mitarbeiter setzt, damit sie auf Elektroautos umsteigen. Dies soll flexibel und jederzeit möglich sein, mehrjährige Leasingverträge für die Dienstwagen seiner Mitarbeiter will das Unternehmen nicht mehr abschließen.
Auch in Bremen ist das Thema angekommen. In den kommunalen Betrieben werden nach und nach die Dienstwagen für die Führungskräfte abgeschafft. Auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft beschäftigten sich mit dem Thema, allerdings sind die Pläne aus verschiedenen Gründen höchst unterschiedlich gereift, wie der WESER-KURIER in einer stichprobenartigen Umfrage festgestellt hat.
Beispiel Sparkasse: Sie hat schon vor vier Jahren ihren klassischen Fuhrpark abgeschafft und durch Car-Sharing-Fahrzeuge des Anbieters Cambio ersetzt. Heute fahren nur noch die vier Vorstände eigene Dienstwagen.
Beispiel Zech Group: 3000 Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark der diversen Firmen unter dem Zech-Dach, vom Kleinwagen bis zum Schwertransporter. Zwei bis vier Jahre seien die Pkw und Nutzfahrzeuge im Schnitt im Einsatz, heißt es. „Damit ist unsere Flotte relativ jung und in Folge dessen auch mit energieeffizienten und sparsamen Motoren ausgerüstet“, sagt Unternehmenssprecher Holger Römer. Elektrofahrzeuge seien nur in Einzelfällen im Einsatz. Sie spielten auf Grund der hohen durchschnittlichen Fahrleistung, die Fahrzeuge bei Zech erbringen müssten, nur eine untergeordnete Rolle.
Siemens bietet seinen Mitarbeitern in Zusammenarbeit dem Autovermieter Sixt jeweils einjährige Mobilitätsprogramme an. Die Kosten für den Leasingvertrag sind dabei an den jeweiligen CO2-Ausstoß des gewählten Fahrzeuges gekoppelt, im Klartext: je mehr CO2 sie ausstoßen, desto teurer sind sie. Innerhalb von 48 Stunden könnten sich Mitarbeiter laut Siemens via App entscheiden, ihr Auto auszutauschen oder phasenweise auch gar keines in Anspruch zu nehmen. Die Corona-Pandemie habe diesen Wandel beschleunigt. Die digitale Kommunikation habe Kundentermine vor Ort ersetzt. Entsprechend habe sich die Zahl der Autofahrten reduziert beziehungsweise auf Stadtfahrten beschränkt.
Dass im Coronajahr 2020 weniger gefahren wurde, hat auch das Deutsche Milchkontor (DMK) festgestellt, eines der größten deutschen Molkereiunternehmen mit Sitz am Flughafen in Bremen. 749 Tonnen CO2 habe man 2020 im Vergleich zu 2019 eingespart, heißt es. „Wir gehen davon aus, dass auch nach Corona die Nutzung von Videokonferenzen auf einem hohen Niveau bleiben wird und damit auch weniger Dienstfahrten notwendig sein werden als zuvor“, teilt das Unternehmen mit.
Noch greifen die DMK-Mitarbeiter auf Dienstautos mit einem herkömmlichen Antrieb zurück. „Zur Verbesserung der Umweltleistung und Reduzierung der Emissionswerte arbeiten wir aber bereits an einem Konzept, um unsere Fahrzeuge sukzessive auf alternative Antriebe umzustellen“, heißt es weiter. Erste Pilotfahrzeuge befänden sich im Test.
Allerdings trifft das DMK auf ein Problem, das auch andere Unternehmen haben: die lückenhafte Versorgung mit Ladesäulen. „Gerade durch die oft ländliche Lage unserer Standorte, national wie international, steht die Infrastruktur nicht immer ausreichend zur Verfügung“, so das Unternehmen. Siemens hat es da leichter. An 450 Standorten verfügt der Konzern bereits über eigene Ladesäulen, bis Sommer 2022 soll das Netz um weitere 260 Stationen ausgebaut werden. Außerdem haben Mitarbeiter dank einer Ladekarte Zugriff auf mehr als 40.000 Landepunkte im öffentlichen deutschen Netz.
Dass die Entwicklung weg vom klassischen Firmenwagen hin zu anderen Mobilitätskonzepten geht, steht für das DMK außer Frage. „Noch ist der Dienstwagen als Statussymbol beliebt“, so das DMK. Aber die Nachfrage nach Alternativen steige, gerade von der jüngeren Generation. Das Jobticket gebe es am Standort Bremen schon. Das Angebot für eine Mobilitätspauschale oder eine Bahncard soll ausgebaut werden. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sagte der Süddeutschen Zeitung kürzlich: „Der Dienstwagen in der klassischen Form verliert Stück für Stück an Bedeutung. Mobilität bedeutet heute mehr als Auto.“