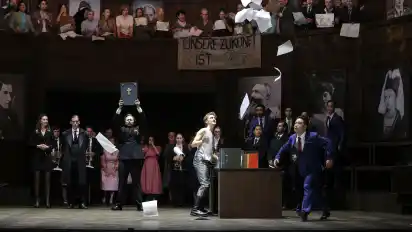Viel Herbstlaub raschelte durch den 200. Saisonauftakt der Bremer Philharmoniker. Die vier letzten Lieder von Richard Strauss künden ja ebenso von Todesahnung wie die 9. Sinfonie des diesjährigen Jubilars Anton Bruckner, über deren Finale der Komponist 1896 verstarb. Selbst Ludwig van Beethovens Ouvertüre zum Schauspiel "König Stephan", die das Philharmonische Konzert in der Glocke eröffnete, trägt einen endzeitlichen Kern in sich. Denn der im Jahr 1000 zum ersten christlichen König Ungarns gekrönte und 1083 heilig gesprochene Stephan I., um den es hier geht, ermordete nicht nur viele "Heiden", sondern ließ auch seine Neffen blenden, um diese potenziellen Thronfolger regierungsunfähig zu machen.
Nun, Beethoven hat das wenig gekümmert, er erprobte lieber die ungarische Folklore und die Kunst der Tonarten-Verschleierung. Nicht ganz so erprobt wirkten indes die Philharmoniker um ihrem Chef Marko Letonja. Der Wechsel zwischen dem viertönigen Ausrufezeichen des Anfangsmotivs und der liedhaften Melodie wirkte ungelenk, die Fortissimo-Passagen klobig, der Jubel-Schluss in den Streichern nicht akzentuiert genug.
Auch Strauss’ Schwanengesang, die vier letzten Lieder von 1948, kamen über weite Strecken recht vordergründig daher. Letonja wollte offenbar jede Jugendstil-Schwülstigkeit vermeiden – allerdings um den Preis einer eher nüchternen Atmosphäre. Auch erwies sich die lyrische Sopranistin Sarah-Jane Brandon vom Theater Bremen nicht als ideale Interpretin für die innere Ruhe dieser Gedichtvertonungen. In Hermann Hesses "Frühling" störte gleich in der zweiten Zeile ("träumte ich lang") das starke Vibrato auf dem letzten Wort, besser lag Brandon der "Vogelsang" in der Höhe. Ansonsten blieben viele Details unhörbar: Immer wieder verschwand die nicht sehr farbreiche Stimme in den Orchesterwogen.
Erst mit dem Solo der Konzertmeisterin Anette Behr-König im dritten Lied "Beim Schlafengehen" kam mehr Wärme ins Geschehen. Am besten gelang die Eichendorff-Vertonung "Im Abendrot", deren leicht hymnische Anlage der Sängerin entgegenkam. Im langen Nachspiel mit dem "Tod und Verklärung"-Zitat und den trillernden Lerchen der Piccoloflöten fand auch das Orchester den passenden elegischen Ton.
Am Hauptwerk des Abends gab es indes keinen Zweifel: Bruckners letzte, alle Kräfte fordernde Sinfonie. Marko Letonja ließ keinen Zweifel, dass es hier um große Musik geht, ließ das Blech im Fortissimo – was bei ihm selten ist – unerbittlich ausspielen. Da stand die Luft.
Die Pauke rumort
Kaum je hat man dieses Werk als so durch und durch düster empfunden. Der Anfang – ein einziges Tasten (mit prompt verstolperten Holzbläsern). Die Pizzikati und ständigen Kreiselbewegungen der Streicher – ein ängstliches Suchen. Die melodiösen d-Moll-Momente – eher Erinnerung an glückliche Zeiten als echte Befreiung. Bruckners Neunte erschien wie ein Gang durch die neun Höllenkreise in Dantes "Inferno", wie das Wirken von Urkräften, selbst in der Stille rumort da noch die Pauke. Ernste Überwältigungsmusik.
Letonja betonte das Prozesshafte, das dauernde Brodeln des Werks. Im gut geprobten Scherzo gab es stampfend was auf die Ohren, aber nichts zu lachen. Der langsame Satz zerfranste zwischen Hörnern und Streichern, Flöte und Tuba, um in einem riesigen Aufbäumen zu explodieren. Auch der "Parsifal"-Anklang, das "Dresdner Amen", brachte wenig Linderung. Die überraschende Wirkung: Am Ende vermisste man tatsächlich den Finalsatz. Man spürte, hiernach müsste eigentlich noch etwas kommen.