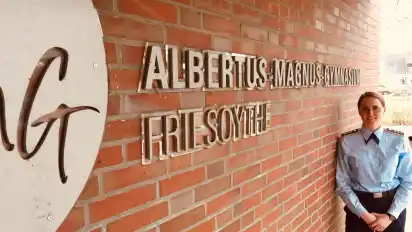Herr Timm, in den vergangenen Jahrzehnten sind in Bremen nach und nach Kasernen geschlossen worden. Das Landeskommando ist geblieben. Jetzt sprechen Politik und Bundeswehrführung von einer Zeitenwende. Ist Bremen strategisches Niemandsland?
Andreas Timm: Nein, in keiner Weise. Ich würde sogar sagen, dass Bremen und insbesondere Bremerhaven mit dem dortigen Seehafen eine besondere Bedeutung zukommt.
Sie sind seit Anfang April neuer Leiter des Landeskommandos. Bei der Übergabe hat Generalmajor Andreas Henne vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine gesagt, wenn der Bündnisfall eintrete, komme den Landeskommandos eine entscheidende Rolle zu. Was heißt das?
Für mich als Leiter des Landeskommandos kommt es darauf an, dass ich alliierten Verstärkungskräften – wir sprechen da in erster Linie von amerikanischen Kontingenten – die Bewegungsfreiheit offenhalte. Es muss gewährleistet sein, dass Schiffe in Bremerhaven anlanden können, dass Material entladen und zu den jeweiligen Einsatzgebieten transportiert werden kann. Es müssen alle zuständigen Akteure ihrer Rolle gerecht werden. Es muss auch zu jeder Zeit Truppe da sein, um diesen Raum schützen zu können. Ich habe mir für meine Zeit in Bremen vorgenommen, dass das, was wir für die Bündnispartner liefern müssen, also die Drehscheiben-Funktion, reibungslos funktioniert.
Welche Aufgabe übernehmen Sie in diesem Fall?
Ich bin das Bindeglied zur zivilen Seite, zum Bürgermeister, also dem Ministerpräsidenten des Landes, aber auch zur Stadt Bremen und zur Stadt Bremerhaven. Kleine Truppenumfänge kann ich auch vom Landeskommando aus führen. Wenn wir über komplexere Operationen sprechen, in der See-, Luft- und Cyberraum, aber auch konkret der Hafen von der Landesseite, geschützt werden müssen, müssen wir überlegen, mit welcher Führungsstruktur der Bundeswehr man das macht.
Wie groß ist das Landeskommando?
Das Landeskommando umfasst 50 Personen. Wenn wir Kräfte im Rahmen der Amtshilfe brauchen – sei es für die Pandemie, sei es für die Deichverteidigung – würde ich auf eine Anfrage der zivilen Seite reagieren. Darüber wird in einem formalen Verfahren in Berlin entschieden und dann werden mir Kräfte für die Durchführung der Amtshilfe zugewiesen. Eine unsere großen Stärken ist dabei, dass wir je nach Aufgabe bundesweit auf Kräfte zurückgreifen können. Die können dann zum Beispiel auch vom Pionierbataillon aus Bayern kommen, die haben dann nur einen längeren Anmarsch.
Wie viele Reservisten kommen hinzu?
Zum einen gibt es Reservisten, die den Personalumfang des Landeskommandos verdoppeln. Diese Kräfte kann ich im Stab einsetzen, um längerfristige Lagen zu bewältigen. Und dann gibt es die Heimatschutzkompanie Bremen mit 120 Dienstposten.
Planen Sie eine neue Heimatschutzkompanie in Bremerhaven?
Das ist der Gedanke. Wir müssen jetzt sehen, wie groß ist der Bedarf und kann ich den mit Ressourcen decken? Wir brauchen im Raum Bremerhaven Reservistinnen und Reservisten, die von ihren Arbeitgebern Zeit bekommen, um zu üben und sich ausbilden zu lassen. Da muss ich auch mit Arbeitgeberverbänden sprechen. Das geht jetzt los. Wir brauchen diejenigen, die unsere Demokratie, unsere Farben schützen wollen. Es gibt auch Menschen, die ich definitiv nicht in der Bundeswehr haben will.
Was kann die Reserve überhaupt leisten?
Wir stellen gerade die territoriale Reserve, den Heimatschutz, neu auf. Die Reserve spielt deshalb eine entscheidende Rolle. Das sind diejenigen Kräfte vor Ort, die eine Schutzaufgabe übernehmen können. Wir werden aber, wenn wir zum Beispiel den Seehafen schützen müssen, nicht nur auf die Reserve zurückgreifen können. Dabei wäre dann die Marine im Spiel, die Luftwaffe bei der Bedrohung durch Flugkörper, die entsprechenden Einheiten bei Angriffen im Cyberraum – das geht dann sehr schnell in die Planungen der integrierten Nato-Luftverteidigung über.
Generalleutnant Markus Laubenthal hat vor der Reservistenarbeitsgemeinschaft Bundestag beklagt, die Reserve sei in Deutschland in den letzten Jahrzehnten strukturell liegen gelassen worden. Und Patrick Sensburg, der Bundesvorsitzende des Reservistenverbands, sagte der Stuttgarter Zeitung, es gebe deutliche Defizite bei der Ausstattung der Reserve.
Ich teile diese Einschätzung. Es ist richtig, dass in den letzten zwei, drei Dekaden das Thema Heimatschutz auf der sicherheitspolitischen Agenda nicht im Fokus stand. Das tut es erst jetzt wieder. Es muss darum gehen, die materielle Ausstattung der Reserve nach vorne zu bringen. Die Reserve hat einen Ausbildungspool an Material, aber sie hat noch keine Vollausstattung.
Wie groß ist die Lücke?
Nicht immer kommen 100 Prozent der Reservedienstleistenden zu einem Ausbildungswochenende. Denn das sind alles Menschen, die das neben ihrem zivilen Erwerbsleben leisten. In der Regel liegt die Antrittsstärke bei einem Drittel bis zur Hälfte. Dafür ist genug Material da. Wenn wir von einem Defizit an modernem Material sprechen, dann geht es um die Lücke zwischen 40 und 100 Prozent.
Treffen sie sich regelmäßig mit Vertretern der Landesregierung?
Wenn die Koalitionsvereinbarungen abgeschlossen sind und die Landesregierung im Amt ist, werden wir unsere Gespräche fortsetzen. Unabhängig von der Entwicklung der Lage in der Ukraine halte ich den Diskurs mit der zivilen Seite für ausgesprochen wichtig. Das wird nicht immer der Bürgermeister sein, das wird auch der Innensenator mit seinen Abteilungsleitungen sein. Polizeipräsident, Feuerwehr-Chef, das sind meine Gesprächspartner. Wir sind eingebunden in die Katastrophenschutzübung Weserdüne, die im September stattfinden wird. Im Zuge der Amtshilfe werden wir da unseren Anteil leisten. Wir sind auch am Vorbereitungsstab mit einem Fachberater beteiligt.
Kommunikation kann eine entscheidende Schwachstelle sein, das hat die Katastrophe im Ahrtal gezeigt.
Im Ahrtal kamen mehrere Dinge zusammen. Die Bundeswehr hat den Einsatz mit Gerät unterstützt. Aber auch mit Führungskompetenz, mit Strukturen, in einer Krisenlage zu führen. Die Arbeit ist eine andere, ob ich mit dem Amt im Bürgerservice bin oder ob ich eine Krisenlage bewältigen muss.
Gibt es eine geänderte Wahrnehmung der Bundeswehr?
Die gibt es. Das Interesse ist da. Dass die Bundeswehr und die Nato da sind, sehen viele als für sie günstig an. Das wird mit anderen Augen gesehen als vor dem Februar vergangenen Jahres. Die Menschen sind verunsichert. Was bedeutet der Ukraine-Konflikt für mich und meine Familie, welche Bedrohung gibt es? Der Bedarf nach sicherheitspolitischer Expertise und Gesprächen ist spürbar, um Unsicherheiten zu klären, um Dinge zu bewerten und nicht Narrativen aufzusitzen, die immer wieder von Putin gebracht werden.
Inwieweit betrifft das auch das eigene Team?
Ein Soldat, der vor 20 Jahren in die Bundeswehr eingetreten ist, der hat Afghanistan erlebt, der hat Mali erlebt, der hat Stabilisierungsmissionen erlebt - aber Landes- und Bündnisverteidigung waren weit, weit weg.
Sie bieten aber auch der Bevölkerung Gespräche an.
Ich möchte gerne all denen, die es wissen wollen, Sicherheitspolitik erklären. Deshalb bin viel in der Gesellschaft unterwegs, man kann sich gerne mit einem Gesprächswunsch an das Landeskommando wenden. Für den Diskurs möchte ich werben. Das Schlimmste, was uns in der Sicherheitspolitik – und in unserer Demokratie – passieren kann, ist, dass viele Menschen gleichgültig damit umgehen. Aber ich glaube, das tun sie mittlerweile nicht mehr. Ich bin seit 1984 in diesem Beruf. Ich habe viele Dinge gesehen, war in Russland, war in China, in Israel, war viel an der Nato-Ostflanke unterwegs von Tallinn bis runter nach Budapest. Dieses Wissen zu teilen und auch meine Position immer wieder zu hinterfragen, das ist mir ein wichtiges Anliegen.