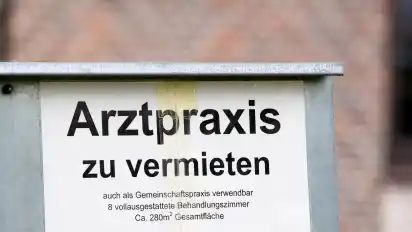Der Befund ist klar: Die ambulante Gesundheitsversorgung wird durch den Mangel an niedergelassenen beziehungsweise niederlassungswilligen Ärzten zunehmend gefährdet. Jedes Jahr werden an den Universitäten etwa 6000 Nachwuchsmediziner zu wenig ausgebildet, um den bundesweiten Bedarf zu decken. Und von denjenigen, die ihr Studium erfolgreich abschließen, haben immer weniger Lust, die klassische Haus- oder Facharzttätigkeit in einer selbstgeführten Praxis auszuüben, die lange Arbeitstage und unternehmerisches Risiko mit sich bringt.
Wie aber umgehen mit dieser Herausforderung? Um diese Frage ging es am Donnerstag in der Gesundheitsdeputation. Grundlage der Diskussion war ein von der CDU angeforderter Bericht der Gesundheitsbehörde. Er stellt fest, dass eine Unterversorgung im ambulanten haus- und fachärztlichen Bereich derzeit noch nicht gegeben ist – was freilich nicht bedeutet, dass es keine Unwuchten bei der Verteilung insbesondere fachärztlicher Praxen in den Stadtgebieten von Bremen und Bremerhaven gäbe. Ganz im Gegenteil: In der Diskussion räumte auch der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Bremen, Peter Kurt Josenhans, ein solches Ungleichgewicht ein. In manchen Stadtvierteln sind bestimmte ambulante Angebote rar, in anderen gibt es eine bis zu 2000-prozentige Überversorgung.
Die KV ist Trägerin des ambulanten Versorgungsauftrags, muss also sicherstellen, dass es in den Kommunen genügend niedergelassene Mediziner gibt. Laut Josenhans bemüht sich die KV darum, freie werdende Arztsitze gerade in bisher schlecht versorgten Stadtteilen anzusiedeln. „Wir gehen mit Bewerbern sehr konkret ins Gespräch und sprechen Empfehlungen aus“, so der stellvertretende KV-Chef. Wo genau sich jemand in Bremen mit einer Praxis niederlasse, könne allerdings nicht von der KV entschieden werden. Dafür gebe es keine rechtliche Handhabe. Angesichts des allgemeinen deutschlandweiten Medizinermangels sei es schon schwer genug, überhaupt Interessenten in die Hansestadt zu lotsen. Die KV versuche das unter anderem mit Investitionskostenzuschüssen und Umsatzgarantien für Praxisgründer. Dafür würden jährlich rund 6,5 Millionen Euro aufgewendet.
Für Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) steht fest: Das bestehende, allein von der KV getragene System ist nicht zukunftsfest. „Man sollte es daher auch nicht künstlich am Leben erhalten“, machte sie in der Diskussion deutlich. Wenn die Kassenärztliche Vereinigung nicht mehr in der Lage sei, ihrem gesetzlichen Versorgungsauftrag nachzukommen, brauche es ergänzend kommunal beziehungsweise staatlich organisierte ambulante Angebote, etwa in Form sogenannter Medizinischer Versorgungszentren (MVZ), in denen angestellte Ärzte tätig sind. Auch eine Ausweitung der ambulanten Versorgung an den Krankenhäusern komme in Betracht. „Die strikte Trennung von ambulantem und stationärem Bereich muss aufgehoben werden“, forderte Bernhard. Eine Anstellung in einem MVZ komme auch dem Wunsch vieler junger Ärzte nach geregelten, nicht überbordenden Arbeitszeiten entgegen. Bernhard machte zugleich deutlich, dass solche alternativen Modelle nicht einfach auf Landesebene beschlossen und umgesetzt werden können. Es brauche dafür auf Bundesebene umfangreiche Veränderungen an den gesetzlichen Grundlagen der ambulanten Gesundheitsversorgung.