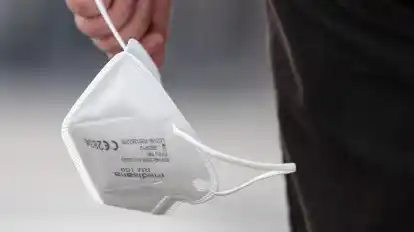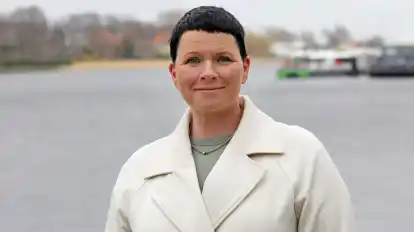Herr Dotzauer, vor ziemlich genau drei Jahren gab es die ersten Nachrichten aus China über eine "mysteriöse Lungenkrankheit". Jetzt gibt es die ersten Entwarnungen auch von Virologen: Die Corona-Pandemie ist so gut wie vorbei – sehen Sie das auch so?
Andreas Dotzauer: Nein, das ist nicht so. Diese Entwarnung ist aus meiner Sicht zu früh.
Warum?
Der Begriff Pandemie bezeichnet eine weltweite Ausbreitung mit einem aktiven Virus – genau das haben wir weiterhin. Im Moment erleben wir nach wie vor eine ausgedehnte Zirkulation des Coronavirus. Und ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, dass das Virus mit seiner Fähigkeit zur Immunflucht – den durch Infektion oder Impfung erworbenen Immunschutz zu umgehen – noch nicht am Ende ist. Das sehen wir gerade ganz massiv an der Ausbreitung der Omikron-Variante XBB.1.5 in den USA.
Wo stehen wir also in der Pandemie – und was kann man erwarten?
Worauf es über die Zeit hinausläuft, würde ich als globale Endemie bezeichnen: Das Coronavirus wird weltweit erhalten bleiben, es ist im Prinzip da, das Virus verschwindet nicht mehr. Es wird dann künftig entweder immer wieder Wellen geben, die in ihren Peaks bei den Neuinfektionen sowie den Hospitalisierungsraten kleiner werden und sich auf ein sehr kleines Niveau einpendeln. Oder aber: Man hat eine Art Schwelbrand mit ständigen Übertragungen, ohne dass man ein besonderes Wellenmuster erkennt. Beides sehen wir im Moment aber noch, es gibt kein stabiles Muster.
Wann werden wir diesen Übergang haben?
Im Moment kann niemand sagen, wann dies soweit sein wird. Was wir allerdings feststellen, wenn man sich die mit den Infektionsanstiegen verbundenen Todesfälle ansieht: Die Sterblichkeit nimmt ab. Das liegt an dem erworbenen Immunstatus und vor allem auch an den Impfungen, inklusive Auffrischungen. Die Krankheitsschwere und die Hospitalisierungsrate nehmen ebenfalls ab. Das ist die gute Botschaft. Grundsätzlich muss man aber davor warnen, das Virus zu unterschätzen. Entscheidend ist vor allem, wie lange der erworbene Immunschutz anhält.
In den USA sorgt XBB.1.5 aktuell für einen massiven Anstieg von Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist sie die bislang ansteckendste Variante, die Organisation warnt vor einer Ausbreitung. Ist die Sorge begründet?
Ja, diese Variante hat die Fähigkeit, die Immunantwort zu umgehen. Das macht sie deutlich infektiöser, man kann sich also leichter anstecken. Verschiedene Sublinien von Omikron BA.2 haben sich hier zu einer neuen Variante kombiniert. Aus Virussicht ist ein noch besseres Modell entstanden, das noch einmal besser an den Rezeptor bindet und schneller in die Zellen aufgenommen wird. Bisher scheint es aber keine Anzeichen dafür zu geben, dass XBB.1.5 schwerere Erkrankungen auslöst als andere Virusvarianten. Der Anstieg der Hospitalisierungen in den USA könnte mit größeren Lücken beim Impfschutz, insbesondere durch Auffrischungsimpfungen, erklärt werden.
Ist damit zu rechnen, dass sich die neue Omikron-Variante aus den USA auch bei uns durchsetzt?
Die Erfahrung mit den bisherigen Varianten zeigt, dass dies wahrscheinlich ist. Die Ausgangsposition ist vergleichbar.
Kann eine solche deutlich ansteckendere Variante auch eine Art Gamechanger sein – also das Infektionsgeschehen und die aktuelle Lage erneut drehen und verschärfen?
Das ist absolut möglich. Sollte sich bei uns eine Entwicklung wie aktuell in den USA abzeichnen, würde das wieder nach neuen Schutzmaßnahmen schreien. Zum Beispiel eine Maskenpflicht.
Dazu kommt die massive Infektionswelle in China. Mehrere EU-Länder, auch Deutschland, wollen für Flugreisende aus China eine Testpflicht einführen. Die Befürchtung ist vor allem auch, dass sich bei so vielen Neuinfektionen neue und gefährlichere Mutationen bilden könnten. Ist diese Sorge berechtigt?
Ja, zum einen mutiert das Coronavirus – wie grundsätzlich alle Viren – weiter, das hört nicht einfach auf. Und bei dieser hohen Anzahl ist die Wahrscheinlichkeit für neue Mutationen, die aus Virussicht noch eine weitere Verbesserung bringen, gegeben. Inzwischen sind so viele Varianten und Sublinien gleichzeitig unterwegs, dass immer diese Gefahr einer Ko-Infektion mit unterschiedlichen Virustypen besteht und damit neue, "bessere" Modelle auftreten.
Knapp zwei Drittel der Deutschen haben die dritte Impfdosis, also eine Auffrischung, erhalten. Dazu kommt die hohe Ansteckungsrate mit Omikron. Wie groß ist damit der Schutz vor weiteren möglichen Corona-Ausbrüchen?
Durch die Kombination Impfung und Infektion haben wir natürlich einen Effekt, der zu einem guten Immunschutz beiträgt - zum Teil auch durch Mehrfach-Impfungen und/oder Reinfektionen. Da kann man sicherlich von einem Anteil von weit über 90 Prozent der Bevölkerung ausgehen. Aber: Der Immunschutz lässt nach einem Jahr deutlich nach. Der vorübergehende Immunschutz ist tatsächlich das Hauptproblem. Insofern sollte man auch bei einer verbleibenden Grundimmunität nicht glauben, man ist auf Dauer geschützt. Das ist sehr voreilig gedacht.
Sind daher künftig regelmäßige Auffrischungsimpfungen gegen Covid sinnvoll, ähnlich wie bei der Grippe?
Davon ist auszugehen. In Studien aus der Omikron-Phase ist belegt, dass Booster-Impfungen mit den angepassten Vakzinen die körpereigene Immunität deutlich erhöhen und auch einen besseren Schutz vor einer erneuten Infektion bieten. Man spricht von einem kumulativen Booster-Effekt. Das bedeutet: Jede Auffrischung bringt einen Zusatznutzen. Auch wenn eine Corona-Infektion als eher milder Atemwegsinfekt verläuft, heißt das nicht, dass man die Infektion unbedingt haben muss. Die akute Erkrankung ist nur ein Teil des Problems, es gibt auch noch andere Effekte wie Langzeitfolgen – also Long Covid – hinzu. Hier gibt es aktuell noch kaum effektive Therapiemöglichkeiten, weil das Krankheitsbild noch nicht vollends erforscht ist.