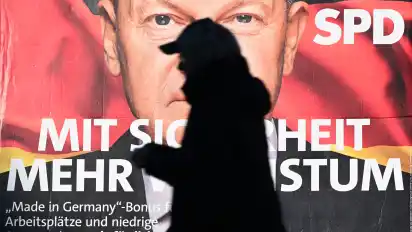A wie Auslandsdeutsche: Am 2. Februar 2025 endet die Frist für Deutsche im Ausland für die Eintragung in das Wählerverzeichnis. Die Eintragung in dieses Verzeichnis ist Voraussetzung, um an der Bundestagswahl teilnehmen zu können. Dazu müssen sich die Betroffenen an ihre letzte Heimatgemeinde oder Heimatstadt in Deutschland wenden. Nach Einschätzung eines Sprechers des Außenministeriums könnten drei bis vier Millionen Personen wahlberechtigt sein. Davon haben sich bei der Bundestagswahl allerdings tatsächlich nur etwa 130.000 Auslandsdeutsche beteiligt, darunter etwa 110.000 Personen, die ihren Wohnsitz in Europa haben. Deutsche, die sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten, aber weiterhin in Deutschland gemeldet sind, können per Briefwahl an der Bundestagswahl 2025 teilnehmen.
B wie Briefwahl: Etwa 370.000 Wahlbenachrichtigungen werden in der Stadt Bremen ab dem 14. Januar verschickt. Mit dem Versand der Briefwahlunterlagen, die die Stimmzettel enthalten, wird Bremen nach Angaben von Landeswahlleiter Andreas Cors voraussichtlich ab dem 5. Februar starten. Diese müssen rechtzeitig zur Wahl am 23. Februar wieder zurückgesandt sein. Wegen der Kürze der Vorbereitungszeit weist der Wahlleiter darauf hin, dass auch direkt in den fünf Briefwahlzentren in Bremen (Altes Postamt 5 in Mitte ab dem 5. Februar, Ortsamt Vegesack, Ortsamt West, Ortsamt Huchting, Ortsamt Hemelingen ab dem 10. Februar) und in den zwei Briefwahlzentren in Bremerhaven (Bürgerbüro Nord ab dem 5. Februar, Briefwahlausgabestelle Hanse Carré ab dem 10. Februar) gewählt werden kann. Im Land Bremen wird mit einem Anteil von Briefwahlstimmen von bis zu 50 Prozent gerechnet.
C wie Christdemokraten: Die beiden Unionsparteien stellen eine Besonderheit dar. Im Gegensatz zu allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien kandidieren CDU und CSU nicht bundesweit. Während die CDU in 15 von 16 Bundesländern auf den Stimmzetteln zu finden ist, stellt sich in Bayern – und nur dort – die Schwesterpartei CSU zur Wahl. Da beide Parteien nirgendwo im Wettbewerb miteinander stehen und die gleichen Ziele verfolgen, dürfen sie eine Fraktionsgemeinschaft bilden.
D wie Duelle: Auch bei dieser Wahl wird es einige TV-Duelle der Spitzenkandidaten geben. Am 9. Februar treffen Kanzler Olaf Scholz und Unionskandidat Friedrich Merz bei ARD und ZDF aufeinander. Für den 13. Februar ist eine Diskussion im ZDF mit den Spitzenkandidaten Scholz, Merz, Robert Habeck und Alice Weidel geplant. Ein weiteres Duell von Scholz und Merz läuft am 16. Februar bei RTL und N-TV. Am 20. Februar gibt es die Schlussrunde in ARD und ZDF, eine Debatte mit allen Spitzenkandidaten.
E wie Erststimme: Bei der Bundestagswahl gibt es zwei Stimmen. Mit der Erststimme auf der linken Seite des Stimmzettels wird der Kandidat in den bundesweit 299 Wahlkreisen gewählt. Zwei davon befinden sich im Bundesland Bremen, 30 in Niedersachsen. Neu ist allerdings, dass der Bewerber, der die relative Mehrheit erobert hat, nur dann in den Deutschen Bundestag einzieht, wenn sein Ergebnis vom Zweitstimmenanteil seiner Partei gedeckt ist.
F wie Fraktionen: Eine Fraktion im Deutschen Bundestag muss aus mindestens fünf Prozent der Bundestagsabgeordneten, also aus mindestens 32 Parlamentariern bestehen, die die gleichen Ziele verfolgen und in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen. Wollen sich Abgeordnete zu einer Fraktion zusammenschließen, ohne diese Voraussetzungen zu erfüllen, muss der Bundestag zustimmen. Fraktionen, die sich im Laufe einer Legislaturperiode trennen und dann unter die Grenze rutschen oder Parteien, die an der Sperrklausel von fünf Prozent der Zweitstimmen gescheitert und über mindestens drei Direktmandate in den Bundestag eingezogen sind, nennen sich Gruppe. So werden derzeit auch die Linke und das BSW bezeichnet.
G wie Grundmandatsklausel: Bei der Verteilung der Sitze im Bundestag werden auch Parteien berücksichtigt, die nicht die Fünf-Prozent-Hürde (Sperrklausel) überwunden haben, aber in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errungen hatten. Die Grundmandatsklausel sollte ursprünglich abgeschafft werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht durch ein Urteil vom 30. Juli 2024 verhindert.
H wie Helfer: Für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl werden in der Stadt Bremen etwa 4000 Wahlhelfer und in Bremerhaven rund 800 Wahlhelfer benötigt. Hinzu kommt noch ein Polster für unvorhergesehene Ausfälle. Für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld, das je nach Funktion und Lokal zwischen 60 und 90 Euro liegt. Landeswahlleiter Andreas Cors setzt bei der Rekrutierung von Wahlhelfern auf das Prinzip der Freiwilligkeit.
I wie Inklusion: Bei der Auswahl der Wahllokale wird darauf geachtet, dass sie möglichst barrierearm zu erreichen sind. Also bestenfalls sollten keine Treppen vorhanden oder alternativ Rampen verfügbar sein, die mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang zum Wahllokal erlaubt. Zudem sind in jedem Wahllokal Schablonen in Brailleschrift für sehbehinderte Personen erhältlich. Personen mit Einschränkungen können außerdem zum Beispiel im Briefwahlzentrum Altes Postamt 5 in Bremen wählen, wo die Auszubildenden der Stadtverwaltung Bremen die Aufgabe übernommen haben, diesen Personenkreis bei der Wahl zu unterstützen.
J wie Jungwählerinnen und Jungwähler: Bei der Bundestagswahl dürfen im Gegensatz zur Europawahl 2024 erst Personen wählen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben. Nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes werden mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt sein, davon dürfen 2.308.000 Menschen zum ersten Mal wählen.
K wie Kanzler: Der Bundeskanzler wird nicht direkt von der Bevölkerung, sondern von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewählt. In den ersten beiden Wahlphasen muss der Kandidat mit absoluter Mehrheit des Bundestags – also dann mit mindestens 316 Stimmen – gewählt werden. In der dritten Wahlphase reicht die relative Mehrheit aus. Der Bundeskanzler muss nicht Abgeordneter des Deutschen Bundestages sein.
L wie Lokal: In der Stadt Bremen gibt es 350 Wahllokale an 148 Standorten. Hinzu kommen etwa 100 Wahllokale in Bremerhaven.
M wie Mehrheitswahl: Die Direktkandidaten in den 299 Wahlkreisen werden nach dem Prinzip der Mehrheitswahl gewählt. Gewonnen hat den jeweiligen Wahlkreis bei den Bundestagswahlen der Kandidat, der die meisten Stimmen erhalten hat (relative Mehrheit).
N wie Nichtwähler: Eine starke Gruppe stellen die Nichtwähler. Von den 61.172.771 Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2021 haben 46.707.343 Personen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 76,4 Prozent. Im Land Bremen lag sie bei unterdurchschnittlichen 71,9 Prozent. Während sich in der Stadt Bremen die Wahlbeteiligung etwa auf Bundesebene bewegte, lag sie mit 67,2 Prozent in der Stadt Bremerhaven deutlich niedriger.
O wie Onlinewahl: Eine Stimmabgabe über das Internet ist bei den Wahlen in Deutschland nicht möglich. Europaweit ist in dieser Hinsicht der baltische Staat Estland ein Vorreiter. Dort wird schon lange online gewählt. Allerdings führt das nicht zu einer höheren Wahlbeteiligung. Bei den Parlamentswahlen 2023 lag sie bei 63,5 Prozent, war also geringer als bei der Bundestagswahl 2021.
P wie Präsident: Der Bundespräsident schlägt nach Gesprächen mit den Fraktionen dem neu gewählten Bundestag eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor. Der Bundespräsident ernennt und entlässt auf Vorschlag des Bundeskanzlers auch die Minister.
Q wie Quote: Bei der Wahl zum Deutschen Bundestags gibt es keine Quoten. Zum Beispiel: Die Länder Thüringen und Brandenburg hatten vor einigen Jahren in ihren Wahlgesetzen eine verbindliche Parität der Geschlechter festgelegt. Das ist allerdings mit der Freiheit und Gleichheit der Wahl nicht vereinbar. Das hat zuletzt das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, als es eine Beschwerde gegen ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtes abgelehnt hatte.
R wie Regierung: Nach der Wahl tritt der neu gewählte 21. Bundestag innerhalb von 30 Tagen zusammen. Da es nicht zu erwarten ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine Regierungsbildung abgeschlossen ist, bleibt die alte Bundesregierung ab diesem Zeitpunkt geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Bundeskanzler gewählt ist und die neuen Ministerinnen und Minister vom Bundespräsidenten ernannt worden sind.
S wie Sperrklausel: Bei der Bundestagswahl werden den Parteien nur dann Sitze zugeteilt, wenn sie mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Diese Sperrklausel bezieht sich ausschließlich auf das Zweitstimmenergebnis. Von dieser Klausel ausgenommen sind nationale Minderheiten: Dazu zählen die Dänen, die Sorben, die Friesen und die Sinti und Roma deutscher Staatsangehörigkeit. Bei den Bundestagswahlen 2021 konnte die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, der südschleswigsche Wählerverband, erstmals nach 60 Jahren wieder ein Bundestagsmandat erringen.
T wie Teilnahme: Insgesamt haben außer den etablierten Parteien, die im Bundestag oder einem Landtag vertreten sind, 56 Parteien und Wählervereinigung ihre Teilnahme an der Wahl bei der Bundeswahlleiterin angezeigt, darunter eher exotische Bewerber wie die „Partei für Motorsport“, die „Anarchische Pogo-Partei Deutschlands“, die „Gartenpartei“, der „Cannabis Social Club“ oder die Döner-Partei. Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden je nach Zuständigkeit die Landes- oder Kreiswahlausschüsse am 24. Januar 2025. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Unterstützungsunterschriften eingereicht wurden. Erst nach diesem Termin werden die Stimmzettel gedruckt.
U wie Umfragen: Wahlumfragen sind keine Wahlergebnisse, sondern lediglich Befragungen, die kontinuierlich gemacht werden. Zuletzt war bei den Landtagswahlen im Osten der Republik zu beobachten, dass sich die Vorhersagen teilweise deutlich vom anschließenden Endergebnis unterschieden. Das liegt insbesondere am hohen Anteil der Unentschlossenen. Nach aktuellen Umfragen liegt dieser Anteil derzeit noch bei etwa einem Drittel der Wahlberechtigten.
V wie Verhältniswahl: Nach dem Verhältniswahlrecht erhalten die Parteien so viele Abgeordnetensitze im Deutschen Bundestag, wie es ihrem Wahlergebnis bei der Zweitstimme entspricht. Damit werden Verhältnisse vermieden wie in Großbritannien, wo bei der Unterhauswahl im Sommer 2024 die Labour Party bei einem Stimmenanteil von 33,7 Prozent dank des dort geltenden Mehrheitswahlrechts in den Wahlkreisen eine absolute Mehrheit von 412 der 650 Mandate erreichte. Der Vorteil des Verhältniswahlrechts liegt in einer präziseren Abbildung des politischen Willens der Bevölkerung im Bundestag. Als Nachteil gilt, dass es dadurch zu schwierigeren Regierungsbildungen von zwei und mehr Parteien kommen kann, die miteinander Bündnisse auf Zeit (Koalitionen) eingehen.
W wie Wahlrechtsreform: In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Deutsche Bundestag ständig größer geworden. Die Zahl der Abgeordneten stieg von 603 nach der Wahl 2002 auf 736 nach der Wahl 2021. Deshalb hatte die Ampelkoalition 2023 das Wahlrecht geändert. Das Problem: Erhielt eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate, als ihr eigentlich über die zweite Stimme zustanden, kam es zu Überhangmandaten. Diese wurden durch zusätzliche Sitze an die anderen Parteien ausgeglichen. Mit der Reform wird der Bundestag nun auf eine Größe von 630 Mitgliedern begrenzt, wovon 299 Direktkandidaten über die Erststimme in den Wahlkreise gewählt werden. Zusätzlich werden 331 Bundestagsabgeordnete über Landeslisten mit der Zweitstimme gewählt. Am Ende muss die Gesamtanzahl der Abgeordneten einer Partei dem Anteil ihres Zweitstimmenergebnisses entsprechen. Das bedeutet, dass ein mehrheitlich gewählter Direktkandidat in einem Wahlkreis unter Umständen den Einzug in den Bundestag verpassen könnte. Sein Ergebnis muss durch die Zweitstimme gedeckt sein. Deshalb spricht man von doppelter Legitimation. Die Begrenzung des Bundestags auf 630 Abgeordnete soll laut Schätzungen des Steuerzahlerbundes eine Ersparnis von 340 Millionen Euro pro Legislaturperiode bringen.
X wie X-Kreuzchen: Davon sollte man auf dem Wahlzettel nicht zu viele machen. Sonst ist das Votum ungültig. Also: jeweils nur ein Kreuzchen bei der Erst- und bei der Zweitstimme. Die sollten mittig in dem dafür vorgesehenen Kreis platziert werden.
Y wie Youtube, Tiktok und Co: Wie groß genau der Einfluss sozialer Medien auf Wahlentscheidungen ist, kann man nicht belegen. Kommunikationsforscher wie Hamburger Professorin Judith Möller gehen aber davon aus, dass die Rolle sozialer Medien in diesem Bereich klein ist und die Wahlentscheidung eher auf sehr viele verschiedene Faktoren wie Herkunft, Erziehung, Bildung und persönliche Erfahrungen zurückgeht. Die Botschaften der Parteien oder ihrer Unterstützer (Influencer) in den sozialen Medien werden im Gegensatz zu klassischen Medien nicht auf inhaltliche Korrektheit geprüft. Insofern lassen sich diese Beiträge eher mit Öffentlichkeitsarbeit als mit klassischen journalistischen Inhalten vergleichen.
Z wie Zweitstimme: Mit der Zweitstimme auf der rechten Seite des Stimmzettels entscheiden sich die Wähler nicht für eine Person, sondern für eine Partei. Auf dieser Liste stehen die Kandidaten, die eine Partei für das Bundesland nach Berlin schicken möchte. Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste an. Wer oben steht, kommt eher dran.