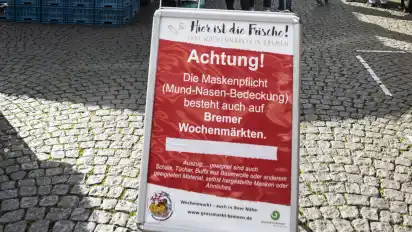Informationen zu den aktuellen Corona-Vorschriften zum Impfen – in anderen Sprachen als deutsch – sind auch im 16. Monat der Pandemie nicht der Standard auf amtlichen Städteportalen im Internet. Ein Vergleich der Webauftritte der 20 größten deutschen Städte ergab für sieben ausschließlich Informationen in Deutsch. Vier Städte boten zwei Sprachen an, darunter auch Hannover und Bremen. Dabei zählt die Version in leichter Sprache, wie sie Hannover bietet, bereits als zweite eigenständige Variante. In Bremen sind die Corona-Informationen auf bremen.de demnach zusätzlich nur in Englisch verfügbar. Als Spitzenreiter werden Berlin mit acht und Stuttgart mit zehn Sprachvarianten genannt. Untersucht wurden die Webseiten vom Unternehmen Preply, einer kommerziellen Online-Lernplattform für Fremdsprachen.
Offenbar wurde bei dem Vergleich auf der Bremer Seite aber der Link auf die „Häufig gestellten Fragen“ übersehen, die in zehn Sprachen die aktuellen Corona-Vorschriften erläutern. Zudem veröffentlicht Bremen die amtliche Corona-Verordnung immer auch auf Türkisch. Unbeachtet blieben bei dem Vergleich zudem weitere Internetauftritt der Behörden zu Corona, die unabhängig vom jeweils amtlichen Stadtportal existieren.
Die Bremer Gesundheitsbehörde hat etwa unter der Adresse www.bremen-gegen-corona.de zahlreiche aktuelle Informationen zusammengefasst. Diese Webseite bietet insgesamt sieben Sprachen: Neben Deutsch und Englisch ist das noch Türkisch, Russisch, Polnisch, Arabisch und Farsi, die Amtssprache in Iran und Afghanistan. Zusätzliche gibt es eine Variante in leichter Sprache, sowie Videos mit Gebärdendolmetschern. „Mit diesem Sprachangebot erreichen wir rund 85 Prozent der fremdsprachigen Einwohner in Bremen“, schätzt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Rund 20.000 Euro hat das Ressort für die Übersetzungen ausgegeben.
Als Grund für den vom amtlichen Portal ausgegliederten Webauftritt gibt der Sprecher das Ziel an, den Corona-Informationen einen insgesamt weniger behördlichen Anstrich zu verpassen. Unabhängig davon bleibt das Problem, die jeweils aktuellen Informationen zeitnah in allen Sprachen vorzuhalten. Die jüngste Meldung zur Möglichkeit, sich ohne Priorisierung online in einer Warteliste des Impfzentrums einzutragen, findet sich auch auf der neuen Webseite bislang nur in deutscher und englischer Sprache. Auch ein näherer Blick auf das zehnsprachige Internet-Angebot in Stuttgart zeigt nicht in allen Sprachen den aktuellen Stand. Vielfach handelt es sich um Broschüren zum Herunterladen, die beim Thema Impfungen beispielsweise den Stand von Januar 2021 wiedergeben.
Sahhanim Görgü-Philipp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bremer Bürgerschaft, sieht unabhängig vom aktuellen Webseiten-Vergleich ein eher grundsätzliches Problem. „Mehrsprachige Informationen für die Bürger sind bei Behörden noch immer nicht selbstverständlich“, sagt sie. Werde das notwendig, wie jetzt in der Pandemie, gebe es dafür keine Standardverfahren. „Lange Zeit war es vor allem dem Engagement einzelner geschuldet, ob es dann Übersetzungen und ein Budget dafür gibt.“
Zugleich bescheinigt Görgü-Philipp den Bremer Behörden, sich bei diesem Thema in den vergangenen Jahren deutlich verbessert zu haben. Das habe nicht zuletzt eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion zu den Sprachbarrieren in der Pandemie ergeben. So gibt es seit dem massenhaften Zuzug von Flüchtlingen 2015 beispielsweise einen Pool von Dolmetschern beim internen Personaldienstleister Performa Nord, auf den jede Behörde zugreifen kann. Die Ämter seien für das Thema Sprachbarrieren insgesamt deutlich stärker sensibilisiert als noch vor zehn Jahren. „Da ist allerdings auch noch Luft nach oben.“
Behördensprecher Fuhrmann betont, dass Internetseiten nicht entscheidend seien, um fremdsprachige Gruppen für Impfungen zu erreichen. Wichtig sei die persönliche Ansprache. „Wir achten bei der Impfkampagne in den Stadtteilen beispielsweise immer darauf, dass Mitarbeiter dabei sind, die auch die Muttersprache der Patienten beherrschen.“ So sei man auch bei den Impf-Angeboten in den Flüchtlingswohnheimen verfahren.
Görgü-Philipp verweist auf die vielfältigen Hilfsstrukturen in den Quartieren. Dazu zählen etablierte Beratungsstellen zu Gesundheits- und Sozialthemen ebenso, wie die eigens wegen Corona engagierten Gesundheitsfachkräfte, die zumeist mehrsprachig unterwegs seien. „Die direkte Ansprache und die lokalen Netzwerke sind der entscheidende Informationskanal“, sagt auch die Politikerin. Sie plädiert dafür, in allen Behörden mehr Menschen mit Migrationsgeschichte zu beschäftigen, die nicht nur sprachlich als Brückenbauer tätig werden können.