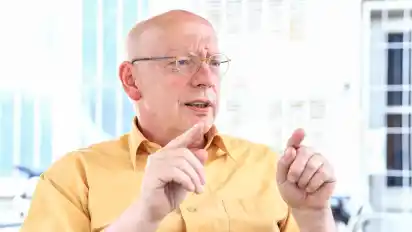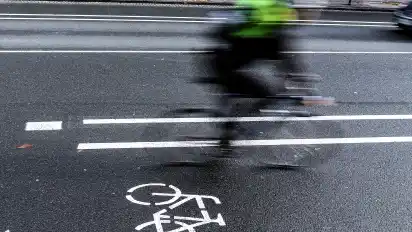Herr Saxe, Ihnen lag und liegt der Verkehrsentwicklungsplan am Herzen. Was sagen Sie als in der Wolle gefärbter Grüner zu den vereinbarten Zielen bis zum Jahr 2030?
Ralph Saxe: Es ist einerseits ein Erfolg, dass wir in großem Einvernehmen Kompromisse gefunden haben. Andererseits gibt es viel Licht, aber auch Schatten.
Was bilanzieren Sie unter Schatten?
Wir äußern uns in einigen Fragen nur sehr vage. Das gilt beispielsweise für die ÖPNV-Finanzierung. Die Koalitionsfraktionen haben dazu unterschiedliche Vorstellungen. Die SPD will den ticketlosen ÖPNV über eine höhere Grundsteuer finanzieren. Die Linken und wir sind der Meinung, dass der ticketlose ÖPNV kommen kann, man den ÖPNV aber massiv ausbauen muss, ohne den Rad- und Fußgängerverkehr zu benachteiligen. Der Nahverkehr muss komfortabel, sauber, pünktlich und kostengünstig sein, um Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umstieg zu bewegen.
Das Modell, dass die Linken und Sie favorisieren, ist das Luxus-Modell: mehr Investitionen in den ÖPNV, aber keine Einnahmen aus dem ÖPNV. Das klingt nach den Maximalforderungen, die sonst gerne aus der Opposition kommen, weil man nicht für die Gegenfinanzierung sorgen muss. Oder setzen Sie auf den Bund?
Auch, aber nicht nur. Er wird unsere Pläne nicht komplett finanzieren, sondern höchstens bezuschussen. Und auch dieses Geld kommt zumindest in Anteilen von bremischen Steuerzahlerinnen und -zahlern. Wir haben Gegenfinanzierungsvorschläge gemacht: Wir setzen auf Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung und auf ein verpflichtendes Jobticket, und wir erwägen eine Abgabe von Berufseinpendlern.
Ist eine solche Abgabe verfassungsgemäß?
Es gibt Juristen, die die Auffassung vertreten, dass man eine solche Abgabe verfassungsfest gestalten kann. Das lassen wir gründlich prüfen. Der bürokratische Aufwand muss auch zu stemmen sein. Das ist uns bewusst.
Auch ein verpflichtendes Jobticket könnte juristisch problematisch sein. Die Grünen plädieren damit – erneut – für einen staatlichen Eingriff in die Wirtschaft. Damit werden sie ihrem Ruf gerecht.
Man muss seriös sagen, wo man das Geld hernehmen will, um den Ausbau des ÖPNV und die Verkehrswende zu finanzieren. Das ist nicht umsonst zu haben, wir reden hier von rund 180 Millionen Euro. Der Nahverkehr wird nie kostenlos sein, sondern höchstens ticketfrei. Klar ist, dass die Bürgerinnen und Bürger dafür in irgendeiner Weise aufkommen müssen. Wir wollen eine Umverteilung zugunsten des Umweltverbunds, also mehr Geld für den ÖPNV, den Fuß- und Radverkehr als für den Autoverkehr – den auch jeder Steuerzahler mitfinanziert.
Was kommt zuerst: das bessere Angebot oder höhere Kosten für Pendler, Arbeitgeber und Menschen, die ihr Auto in Bremen parken?
Was nicht funktioniert: 20 bis 30 Prozent mehr Fahrgäste, ohne dass das Angebot angepasst wird. Der ÖPNV muss leistungsfähig genug sein. Das Neun-Euro-Ticket ist ein gutes Beispiel: Es hat viele Menschen zum Umsteigen bewegt. Manche hat es auch abgeschreckt, weil sie stundenlang im Zug stehen müssen oder ihr Fahrrad plötzlich nicht mehr mitnehmen können. Aber in das Thema ist sehr viel Bewegung gekommen. Es gibt viele Vorschläge für Nachfolgemodelle. Das geht in die richtige Richtung.
Kommt dieses Thema nicht dennoch zur Unzeit? Die Bürger bekommen die hohe Teuerungsrate zu spüren und müssen mit weiteren Mehrbelastungen wegen der Gaskrise rechnen. Obendrein sollen sie über die Grundsteuer oder eine Pendlerpauschale belastet werden?
Wir brauchen unglaubliche Summen nicht nur für Mobilität, sondern auch für die Wärmeversorgung und Altbausanierung – zugunsten des Klimaschutzes. Die Klimaenquetekommission hat für Bremen einen Finanzbedarf von rund sieben Milliarden Euro bis 2030 errechnet. Das ist aus dem regulären Haushalt nicht zu stemmen. Wir Grüne sind dafür, die Schuldenbremse dafür auszusetzen, um die enormen Investitionen schultern zu können. Die Klimakrise ist aus unserer Sicht eine der Notlagen, die das Grundgesetz als Ausnahmesituation anerkennt. Es wird zu einer Mischfinanzierung kommen müssen.
Es gibt noch einen Punkt, der Ihren Plänen im Weg steht: der Personalmangel. Die BSAG musste ihren Fahrplan kürzlich reduzieren. Das hängt auch mit der Pandemie zusammen, aber nicht nur, sondern auch mit dem Fachkräftemangel.
Das bereitet mir tatsächlich derzeit große Sorgen, denn auch in der Verwaltung können viele Stellen nicht besetzt werden. Wir stehen in Konkurrenz zu anderen Städten, was beispielsweise Stellen für Stadt- und Verkehrsplaner betrifft. Auch im Tiefbau fehlen Mitarbeiter. Das ist momentan der Flaschenhals der Verkehrswende. Wenn wir es nicht hinbekommen, umfangreicher selbst auszubilden, können wir so viele Pläne schmieden wie wir wollen, aber wir werden sie nicht umsetzen können. Wir brauchen eine Ausbildungsinitiative, zusätzliche Professuren und duales Masterstudium in diesem Bereich.
Der Zeitpunkt für die Fortschreibung ist auch in anderer Hinsicht unglücklich – zehn Monate vor der Wahl. Hätte man unter anderen Umständen aus Ihrer Sicht vielleicht weniger Zugeständnisse machen müssen?
Durch die Pandemie und den Verkehrsversuch hat sich der Prozess in die Länge gezogen. Wir wollten schon vor einem Jahr fertig sein. 2014 haben wir den Verkehrsentwicklungsplan als Kompromiss aller gesellschaftlichen Gruppen hinbekommen, das ist ungewöhnlich, und darauf können wir als Stadt stolz sein. Aber es stimmt: Direkt nach Wahlen oder in der Mitte der Wahlperiode wäre uns die Arbeit vermutlich leichter gefallen. Beim Thema Bewohnerparken wären wir wohl weitergekommen.
Ganz so breit ist das Bündnis dieses Mal allerdings nicht, das die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans mitträgt: Der BUND und der ADFC sind offenbar enttäuscht. Die CDU ist aus dem Prozess ausgestiegen, die Handelskammer lehnt den Plan in weiten Teilen ab.
Die CDU ist eine von 20 Institutionen und Interessengruppen, die an diesem Prozess beteiligt waren. Aus strategischer Sicht habe ich Verständnis für diesen Schritt, weil die CDU damit die Gelegenheit zu einem politischen Paukenschlag hatte. Aber die Rolle der Opposition ist es einerseits, die Regierung zu kontrollieren und sich andererseits darauf vorzubereiten, irgendwann an einer Regierung beteiligt zu sein. Die CDU hätte eigene Vorstellungen einbringen können. Mit dem Ausstieg hat sie alles das unterbunden.
In der Martinistraße stauen sich tagtäglich die Autos im Berufsverkehr. Stop-and-Go-Verkehr gilt als besonders umweltschädlich und erhöht die sogenannte Aufenthaltsqualität nicht. Die Buslinie 25 leidet unter Verspätungen. Das ist keine gute Werbung für den Verkehrsentwicklungsplan.
Der Rückbau der Martinistraße ist mit Zustimmung der Handelskammer und der CDU erfolgt. Aber davon abgesehen: Die Verspätungen der Linie 25 sind ärgerlich. Da wird nachgebessert. Auch die Ampelschaltung soll angepasst werden, um die Staus zu vermeiden.
Hätte man das nicht vorher simulieren und absehen können, nein, müssen?
Das mag sein. Aber man darf diese Entscheidung nicht nur aus Sicht der Verkehrsteilnehmer betrachten. Diese Veränderung hat ein unglaubliches Potenzial für die Stadtplanung und die Entwicklung in der Innenstadt. Selbst das Thema Autoposer gehört dort jetzt weitgehend der Vergangenheit an. Ich verspreche mir auch viel vom Rückbau der Bürgermeister-Smidt-Straße. Dort hoffen wir auf ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Inwiefern?
Zum Beispiel gibt es die Chance, dass eine Brücke – die Bürgermeister-Smidt-Brücke – mehr ist als nur ein Bauwerk zum Zweck der Weserüberquerung. Warum soll man dort nicht sitzen und auf den Fluss schauen können? Die städtebauliche Aufwertung der Langemarckstraße sollte damit verbunden werden.
Ein weiteres großes Thema ist das Bewohnerparken. Es mag sein, dass aufgesetztes Parken jahrelang toleriert wurde, aber eigentlich verboten ist. Der Verkehrsentwicklungsplan sieht vor, dass nicht nur die Beiräte, sondern auch die Anwohner bei Überlegungen zum Parken eingebunden werden. Liegt damit nicht auf der Hand, dass es bleibt, wie es ist?
Das kommt auf das Quartier an. In Findorff besitzen rund 56 Prozent der Haushalte kein Auto, und es waren Anwohner, die gegen das aufgesetzte Parken geklagt haben.
Und in Schwachhausen?
Dort gibt es mehr Autobesitz, und es könnte anders sein.
Das müsste man aber auch akzeptieren, auch als Grüner.
Sicher. Bürgerbeteiligung und Demokratie können dazu führen, dass es zu Ergebnissen kommt, die einem nicht behagen.
Die Frage ist nur: Wo sollen die Bewohner denn parken, wenn das weitverbreitete aufgesetzte Parken unterbunden wird? Oder sollen sie nicht gar nicht parken, sondern ihr Auto abschaffen?
Uns geht es in erster Linie darum, Fremdparker aus den Wohnvierteln zu verdrängen. Deshalb ist das Bewohnerparken mit Ausweis eine gute Lösung, die wir beispielsweise in Schwachhausen ausweiten wollen. Wir wollen es den Bremern aber auch leichter machen, sich gegen ein eigenes Auto zu entscheiden. Der Bericht der Klimaenquete sieht vor, dass sich die Zahl der Autos bis 2030 um 30 und bis 2038 um 65 Prozent reduzieren soll.
Das heißt, der Druck auf die Autofahrer wird Schritt für Schritt so erhöht, dass sie ihren Wagen abschaffen?
Wir bieten ihnen Alternativen: Mir schwebt vor, dass die Stadt mit Mobilitätshubs überzogen wird. Im Abstand von rund 250 Metern soll es einen Knotenpunkt für unterschiedliche Mobilitätsangebote geben. Dort gibt es nicht nur Ladesäulen für E-Autos, sondern dort kann man sich auch Carsharing-Pkws, E-Roller oder Lastenräder ausleihen, um jeden Weg so komfortabel wie möglich erledigen zu können, auch wenn dort kein Bus und keine Bahn fahren oder man etwas transportieren muss.
Wie wollen Sie das finanzieren?
Die freien Kräfte des Marktes werden das nicht richten, vor allem nicht in den Randbezirken. Wir werden ein solches Konzept finanziell unterstützen müssen. Es ist die Ergänzung zum Ausbau des ÖPNV, ohne die wir die Verkehrswende meines Erachtens nicht hinbekommen werden.
Momentaner Stand der Verkehrsentwicklung ist aus Sicht von Autofahrern: mehr Staus – wie in der Martinistraße –, perspektivisch weniger Parkplätze für Anwohner, höhere Parkgebühren in der Innenstadt. Die Gretchenfrage ist: Wollen Sie Pkw-Fahrer quasi zum Aufgeben zwingen oder sie verlocken?
Durch Staus werden wir niemanden zum Umstieg bewegen. Auch mit Zwang erreicht man weniger als durch positive Anreize und überzeugende Alternativen. Der Prozess, den wir angegangen sind, erstreckt sich über mehrere Jahre. Wir sind mittendrin. Wir werden den Autofahrerinnen und Autofahrern den Umstieg nach und nach erleichtern.