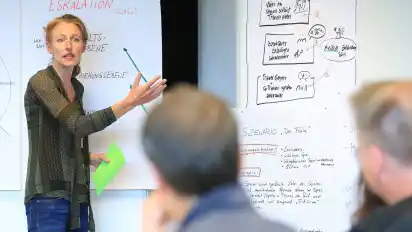Das Letzte, woran sich Tim Bulck noch erinnert: dass er und der Trainer der gegnerischen Mannschaft ein Kind aus dem Spielfeld nehmen wollten. Dann hat Bulck plötzlich nur noch Sterne gesehen. Was er nicht sehen konnte: Dass der Vater des Kindes sich ihm von hinten angenähert und ihn mit einem Faustschlag niedergeschlagen hat, ehe jemand etwas dagegen unternehmen konnte.
Das war vor sechs Jahren, für Bulck war es sein erstes Spiel als Trainer. Trainiert hat er Kinder im Alter von etwa zehn Jahren, Klasse E-Junioren. In einem lokalen Verein. Dort, wo eigentlich Spaß und Sport an erster Stelle stehen sollten, treten nicht selten die Konflikte in den Vordergrund. „Bei den Eltern hat das oft mit Emotionen zu tun – wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind angegriffen wird“, reflektiert er. „Manche sehen in dem Fall nur ihr Kind.“ Aus dem Vorbild kann dann binnen Sekunden ein negatives Beispiel werden.
Das weiß auch die Mediatorin Anja Griese-Tola; nicht aus direkter Erfahrung, sondern weil sie es in ihren Seminaren schon so oft gehört hat. Griese-Tola hat am Sonnabend einen Workshop über den Umgang mit Konflikt für Trainer und Schiedsrichter in den Räumen des Bremer Fußball-Verbandes geleitet. „Wir brauchen Konfliktmanagement, vor allem in männerdominierten Sportarten“, sagt sie. Das Problem vom aggressiven Verhalten im Sport sei allerdings nicht auf ein bestimmtes Niveau oder eine Liga begrenzt. Je nach Alter und Kategorie ergäben sich verschiedene Konstellationen. „Bei den Jüngeren sind es meistens die Eltern oder der Trainer, bei den Erwachsenen eher die Spieler selbst oder die Zuschauer.“
Die Veranstaltung ist nur ein erster Schritt, damit die Vereine auf solche Vorfälle besser reagieren können, erläutert Organisator Jens Dortmann. Dortmann ist stellvertretender Geschäftsführer des Bremer Fußball-Verbandes. Die Idee sei genau aus den Gesprächen mit den Verbandsmitgliedern entstanden. Und durch die wiederholten Vorfälle auf dem Spielfeld. „Das Thema kam immer mehr auf“, sagt er. Ob das mit einer Zunahme an Aggressionen und Gewalt im Sport einhergehe, könne er nicht sagen. „Konflikte und Angriffe auf dem Spielfeld hat es leider auch früher gegeben.“ Sein Eindruck sei jedoch, dass die Hemmschwelle gerade sinke und extreme Ausprägungen häufiger aufträten.
Extrem war auch das, was Trainer Bulck widerfahren ist. „Wir mussten dann vor Gericht“, sagt der junge Mann in Jeans und schwarzem Sport-T-Shirt. Glücklicherweise seien Episode wie diese Einzelfälle. Allerdings passiere bei fast jedem Spiel etwas, fügt er hinzu. Meistens, das bestätigen auch die anderen Veranstaltungsteilnehmer, sind es verbale Ausschreitungen. Auch sie können jedoch schwere Folgen haben. Am schwersten hätten es die Schiedsrichter, weil sie nicht nur von der gegnerischen Mannschaft und deren Fans angegriffen würden, sondern von allen Seiten. „Für sie ist die psychische Belastung dann enorm groß“, sagt Griese-Tola.
"Mein Eindruck ist, dass die Hemmschwelle sinkt"
Solche Erfahrungen kennt auch Mohammed Chabo, der in der Bremen-Liga als Schiedsrichter-Assistent tätig ist. „Ich habe schon in allen Verbands- und Bezirksligen gepfiffen“, sagt er. „Manchmal passiert so etwas oft, manchmal weniger.“ Aber es passiert – immer wieder. Irgendwann, sagt er, gewöhne man sich daran. „Die Erfahrung ist wichtig.“ Er versucht, die Situation auch aus der Perspektive der Spieler und des Trainers zu sehen.
Einmal habe eine große Gruppe von Fans seine Entscheidungen kritisiert und ihn von den Rängen immer lauter beleidigt, erzählt Chabo. „Dann habe ich mich irgendwann umgedreht und sie angelächelt.“ Viel mehr habe er nicht tun können, sein Spielraum sei begrenzt gewesen. Doch die Reaktion habe nicht die gewünschte Wirkung erzielt, die Rufe seien noch lauter geworden. Eine psychologische Erklärung dafür liefert die Kursleiterin: Durch das Lächeln hätten sich die protestierenden Zuschauer nicht ernst genommen gefühlt.
Die Strategien zur Konfliktlösung hingen von der Situation ab. „Es ist jedenfalls wichtig, auf der Emotionsebene zu arbeiten“, sagt Griese-Tola. Oft gehe dabei schon gar nicht mehr um den Inhalt der Kontroverse, um die kritisierte Entscheidung des Spielleiters oder des Trainers. Es ist dann das Gefühl, jemandem wäre unrecht getan worden, der Auslöser. Das konkretisiert sich an mehreren Beispielen, die die Teilnehmer erzählen.
So war es auch in Bulcks Fall: „Der Vater – das ist später deutlich geworden – dachte, ich hätte seinen Sohn angebrüllt. Hatte ich aber nicht“, sagt er. Das Kind sei aus anderen Gründen wütend gewesen und hätte zu dem Zeitpunkt kaum noch gespielt. Daher die Entscheidung der Trainer, den Jungen aus der Partie zu nehmen. „Als ich wieder zu mir kam, habe ich zuerst Eltern und Mannschaft isoliert und sie in die Kabine gebracht. Das war wichtig, damit die Lage nicht weiter eskaliert“, erinnert sich Bulck.
Heute erzählt der ehrenamtliche Trainer die Episode mit einem heiteren Ausdruck. Nach der Erfahrung hätten andere vielleicht das Handtuch geworfen. Aber nicht er. Der Schock hat seine Leidenschaft für den Sport nicht gemindert. Im Gegenteil, das ist sein Ansporn gewesen. „Ich habe nie daran gedacht, aufzuhören. Ich war der Meinung, das sei ein Unding und wollte etwas dagegen tun“, sagt er. Er habe gelernt, sich vor den Spielen mit Schiedsrichter und Trainern auszutauschen und ein Verhältnis aufzubauen, damit alle zum friedlichen Ablauf des Spiels beitrügen.
Doch wie kann es sein, dass Eltern handgreiflich werden, wenn jemand ihre Kinder anschreit? „Ich würde nicht pauschalisieren. Es sind nicht die Eltern, sondern Einzelpersonen, die so reagieren“, sagt Dortmann. Auch Spieler, Trainer oder Fans griffen zur verbalen oder gar physischen Gewalt, merkt Griese-Tola an. Im Allgemeinen sinke die Akzeptanz für die Fehler oder die Fehlentscheidungen anderer. „Wir haben beschlossen, die Veranstaltung für Trainer und Schiedsrichter gemeinsam zu organisieren, damit sie beide an einem Strang ziehen“, sagt sie. Alleine reiche das aber nicht aus. Das Bewusstsein für solche Themen müsse auch in der Bevölkerung wachsen. Griese-Tola plädiert für mehr Toleranz. Man müsse dazu immer bedenken, dass es vor allem ehrenamtliche Trainer und Schiedsrichter seien, die den größten Teil der Spiele ermöglichten.