Herr Bührig, denkt man an Psychiatrie, dann eher ans große Klinikum Ost als ans kleine Behandlungszentrum Nord. Wie oft haben Sie das schon gehört?
Martin Bührig: Ziemlich oft. Dass man erst an Ost denkt, hat ja auch eine gewisse Berechtigung. Das Behandlungszentrum ist schließlich aus dem Krankenhaus hervorgegangen. Und beide Kliniken arbeiten auch eng zusammen.
Und wie häufig ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass Ihr Zentrum – wie vor Kurzem – einen Preis bekommen hat und das Klinikum Ost leer ausging?
Das ist bisher noch nie vorgekommen.
Wie das? Schließlich gilt das Behandlungszentrum doch als Vorreiter bei der psychiatrischen Versorgung von Patienten.
Wir gelten als Vorreiter, weil es ein Konzept, so wie wir es verfolgen, nirgendwo im deutschsprachigen Raum gibt. Und dieses Konzept hat nun einen Preis bekommen.

Martin Bührig
Das Zentrum ist dafür ausgezeichnet worden, vieles anders zu machen als andere Häuser. Aber das macht es doch schon seit Jahren. Warum erst jetzt die Auszeichnung?
Aus einem simplen Grund: Das Zentrum hat sich erst jetzt um diesen Preis beworben. So wie 15 andere Institutionen auch.
Und was bedeutet der Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie für Sie?
Der Preis ist nicht irgendein Preis, weil auch die Gesellschaft nicht irgendeine Gesellschaft ist. Sie stellt in Deutschland das Zentrum innovativer Behandlungsmethoden dar, um die Psychiatrie menschlicher zu machen. Ich habe noch Bettensäle mit zig Patienten erlebt. Häuser, in denen sie wie in einer Kaserne lebten. Und Psychiater, die ihnen eine Therapie verschrieben – und Wochen später schauten, ob die Therapie angeschlagen hat.
Im Haus am Aumunder Heerweg werden Patienten nicht mehr von einem einzelnen Psychiater betreut, sondern von sogenannten multiprofessionellen Teams. Wie muss man sich das vorstellen?
Sie sind der Kern des Konzepts. In anderen Häusern gibt es feste Teams für eine Station. Bei uns gibt es dagegen feste Teams für einen Patienten. Es ist dort, wo auch er ist.
Wie meinen Sie das?
Wechselt der Patient von der stationären Versorgung zur ambulanten, behält er sein Team. Es wechselt mit ihm, sodass er sich nicht wieder an Menschen, die ihm helfen wollen, neu gewöhnen muss. Das hat Vorteile.
Und welche?
Wir wollen die Beziehung zum Patienten verbessern. Und das schaffen wir nur, wenn wir diese Beziehung nicht ständig unterbrechen. Patienten, die zu uns kommen, haben nicht selten schlechte Bindungserfahrungen gemacht. Bei uns bekommen sie Verlässlichkeit und können somit leichter Vertrauen aufbauen. In der Psychiatrie ist es die Beziehung, die heilt – und nicht das Medikament.
Wie viele Teammitglieder kümmern sich denn um einen Patienten?
Ein Team besteht aus sechs bis acht Fachkräften: aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Therapeuten, Pflegekräften. Jeder aus diesem Behandlungsteam hat bis zu sechs Patienten. Aktuell gibt es drei Teams.
Und auf wie viele Mitarbeiter und Patienten kommt das Behandlungszentrum momentan?
Wir haben 85 Beschäftigte. Auf die kommen 44 stationäre und 43 ambulante Patienten. Das Verhältnis ist also eins zu eins. Und damit anders als in anderen Psychiatrien, die nicht selten 100 Betten haben und 20 Tagesklinikplätze.
Wer zu Ihnen kommt, entscheidet mit, wie behandelt wird. In welchen Fällen ist das?
Wir denken, dass hinter jeder Diagnose eine individuelle Geschichte steht. Darum nennen wir unseren Behandlungsansatz auch einen personenspezifischen Ansatz. Es gibt auch einen störungsspezifischen, der davon ausgeht, dass eine Erkrankung immer die gleichen pathologischen Vorgänge hat. Doch in der Psychiatrie ist das anders. Was einen Menschen in eine Krise stürzt, ist nicht immer gleich. Darum müssen wir mit ihm darüber sprechen, was ihm guttut und was nicht.

Über alles wird gesprochen, wenn ein Patient sprechen will: Er entscheidet mit, wie die Behandlung weitergeht.
Und wann entscheidet der Patient nun mit?
Er entscheidet mit darüber, wann beispielsweise ein Wechsel von der stationären zur ambulanten Versorgung anstehen soll. Ob er Medikamente will oder nicht. Und wenn ja, welche.
Das Bild einer klassischen Station, heißt es, gibt es im Behandlungszentrum nicht. Und auch keine geschlossene Abteilung im herkömmlichen Sinn. Welchen Unterschied gibt es denn zum Klassischen und Herkömmlichen?
Wir haben keine Stationen, sondern Ebenen. Jede von ihnen hat einen Empfang, einen Aufenthaltsraum und einen Trakt mit den Zimmern der Patienten und den Räumen für Therapien. Alles ist so offen gestaltet wie möglich. Es gibt frühere Patienten, die auf einen Kaffee vorbeikommen. Und Menschen, die sich bei uns an den Frühstückstisch setzen, obwohl sie eigentlich zu Hause betreut werden. Die Tür ist nur in Ausnahmefällen zu.
Es ist mal gesagt worden, das Konzept sei so erfolgreich, dass die Zahl der Zwangsmaßnahmen und Medikamenteneinsätze niedriger ist als in anderen psychiatrischen Kliniken. Wie viel niedriger ist sie denn im Vergleich?
Im stationären Bereich sind wir bei Medikamentenkosten von 3,60 Euro pro Patient und in der Ambulanz bei 2,20 Euro. In anderen Kliniken sind die Kosten doppelt so hoch. Zudem sind bei uns bedeutend seltener Fixierungen notwendig als in vielen anderen Häusern.
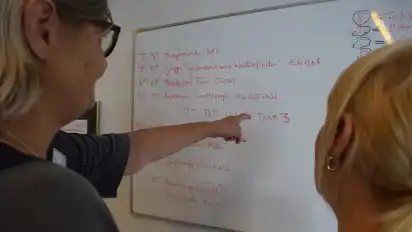
Was wird wann im Haus angeboten: Ein regelmäßiges Programm soll den Patienten einen Halt im Alltag geben.
Wenn es alles so gut läuft – warum ist dann das Behandlungszentrum immer noch ein Vorreiter und nicht längst ein Haus von vielen, die so arbeiten?
Wir hatten das Glück, dass die Bremer Politik es unterstützt hat, Behandlungen zu regionalisieren und ambulanter zu machen. So konnten wir zur Speerspitze eines neuen Versorgungssystems werden. In anderen Bundesländern wird anders gedacht und gerechnet. Dort gibt es oft auch weniger Anreize, mehr stationäre Betten in ambulante und tagesklinische Plätze umzuwandeln. Stationäre Leistungen werden bei ihnen oft besser vergütet. In Bremen dagegen ist mit den Kassen ein festes Budget für Patienten ausgehandelt worden, sodass es finanziell gesehen keine Rolle spielt, ob er stationär versorgt wird oder ambulant.
Und was wird das Zentrum als Nächstes anders machen als andere?
Wir wollen die Versorgung der Patienten zu Hause weiterentwickeln. Mitglieder der Behandlungsteams sollen sie noch häufiger als bisher nicht nur beim Wechsel von der Station in die Tagesklinik begleiten, sondern auch von der Tagesklinik ins private Umfeld.





