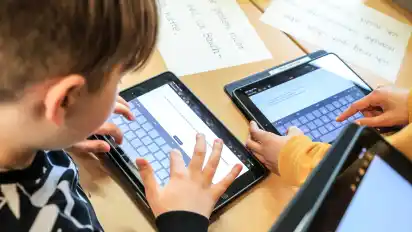Noch sind Ferien, doch in Kürze geht es wieder los. Die Lust auf die Schule dürfte nicht nur bei einigen Schülern gering ausfallen. Corona-Frust: Bei der Hälfte von 1300 Schulleitern ging die Arbeitsmotivation während der Pandemie in den Keller. Sie würden den Beruf „wahrscheinlich nicht“ oder sogar „auf keinen Fall“ weiterempfehlen. Der Grund: Mehr Aufgaben, wenig Zeit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Befragung, beauftragt vom Verband Bildung und Erziehung. Gestresst sind auch die Lehrer – zeigt eine weitere Studie. Ein Versuch, die Stimmung an Nordbremer Schulen zu ergründen.
Eine Schulnote für die Stimmung an den Schulen im Bremer Norden will die Sprecherin der Bildungsbehörde, Maike Wiedwald, nicht vergeben. „Wir haben keine Befragung gemacht“, erläutert sie. Dass es aber durchaus Klagen über zusätzliche Organisationsarbeit von Seiten der Schulleitungen gibt, werde bei der von der Behörde eingerichteten "E-Mail-Sprechstunde" deutlich. Hier können die Rektoren Fragen zu Abläufen und Regelungen stellen, oder dazu, wie sie Materialien abrechnen sollen.
Seit Corona organisiert Stephan Wegner, Schulleiter an der Oberschule In den Sandwehen, zusammen mit dem Hausmeister 3500 Corona-Tests die Woche, dazu kommen Masken. Die ersten Masken nähte der Schulverein noch selbst, auch die ersten Co2-Melder erstellte die Schule in Eigenarbeit: „Die Kollegen haben am Wochenende gelötet und geschweißt.“ Die Schule habe die ganze Zeit über im Team gearbeitet. Doch: „Corona hat uns kalt erwischt, und gezeigt, dass wir Schule komplett neu denken und organisieren müssen.“
Extreme Belastung für Schulleitung
Stephan Wegner übt den Job des Schulleiters seit 30 Jahren aus. „Der Job macht Spaß“, sagt er auch heute noch. Der Rektor sagt aber auch: „Die Belastung eines Schulleiters hat extrem zugenommen.“ Dieser müsse sich heute auch um die Finanzen der Schule und die Personalakquise kümmern. Vor allem Letzteres sei problematisch: Mathe-Lehrer sind Mangelware, Sonderpädagogen und Arbeitslehre-Lehrer kaum zu bekommen.
Inzwischen ginge vielen Schul-Beschäftigten die Luft aus: „Wir kommen an unsere Leistungsgrenzen“, sagt Wegner. Mit jeder Welle hätten die Schulen, politisch bedingt, neue Organisationsformen schaffen müssen. Der Rektor geht davon aus, dass Corona nicht von heute auf morgen verschwindet. „Hier müssen für Schulen Standards für den Umgang mit der Pandemie entwickelt werden. Es darf keine Interpretationsspielräume geben.“
Seine Kollegin Kirsten Addicks-Fitschen, Schulleiterin der Oberschule an der Lerchenstraße, geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt: "Die Belastungsgrenze ist schon überschritten." Der Corona-Frust sei an ihrer Schule durch die zusätzliche Aufgabenschwemme groß. "Jeden Morgen muss getestet werden. Das dauert mindestens eine Stunde, und wenn ein positiver Fall auftritt, sind wir bis 11 oder 12 Uhr damit beschäftigt, Kontaktpersonen zu ermitteln." Zehn-Stunden-Tage ohne Pause seien an der Tagesordnung. "Das macht man nicht alles einfach so."
Es sei deutlich geworden, dass Corona auch enorme Auswirkungen auf die Schüler hat. "Das merken wir am Verhalten. Sie sind aggressiver, weniger empathisch und sie haben viel Unterstützungsbedarf." Einige Schüler hätten während des Lockdowns verlernt, deutsch zu sprechen. Lernrückstände aufholen, Probleme besprechen, all das koste Zeit. "Wir brauchen Personal. Zurzeit haben wir für 1000 Schüler einen Sozialpädagogen."
Bundesweit herrscht Lehrkräftemangel
Lehrkräftemangel gibt es nicht nur in Bremen-Nord: Der Forsa-Befragung zufolge bleibt fehlendes Personal bundesweit das größte Problem der Schulleitungen. Gerade Schulen am Rande Bremens haben es laut Stephan Wegner aufgrund der langen Wege schwer, Personal zu finden: „Da muss man sich schon etwas einfallen lassen.“ Die Oberschule In den Sandwehen zum Beispiel ist dazu übergegangen, selbst Anzeigen zu schalten. Doch selbst, wenn junge Kräfte an die Schule kommen, sind sie schnell wieder weg. Kirsten Addicks-Fitschen: "Die Fluktuation ist enorm. Wir haben in Bremen-Nord immer mehr schwierige Kinder. Es ist nicht so wie an anderen Standorten. Wir haben hier große Herausforderungen zu meistern."
Nicht nur die Stimmung bei vielen Schulleitungen ist in der Corona-Zeit gekippt. Christian Dirbach, Lehrer für Geschichte und Sport an der Oberschule an der Egge, arbeitet seit zwei Jahren im Personalrat. Dort bekommt Dirbach jede Menge Frust seiner Kollegen mit. „Auch für die Beschäftigten gab es erhebliche Mehrarbeit und andere Stressfaktoren.“ Christian Dirbach verweist auf die repräsentative Studie „Digitalisierung im Schulsystem 2021“ der Kooperationsstelle der Universität Göttingen.
An der bundesweiten Studie waren 2750 Lehrkräfte beteiligt, darunter auch Lehrkräfte aus Bremen. „Es ging um Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und Perspektiven von Lehrkräften“, so Dirbach. „Die Ergebnisse zeigen grundsätzlich eine hohe Durchschnittsbelastung sowie eine längere Arbeitszeit durch die Pandemie getriebene Digitalisierung." Bremen hatte großzügig I-Pads an Schüler verteilt. "Laut Studie überschreiten 26 Prozent aller Lehrkräfte während der Schulzeit die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden, und das sind eben nicht nur Schulleitungen.“
Gestiegene digitale Anforderungen
Den im Pandemie-Zeitalter gestiegenen Anforderungen an das digitale Lehren und Lernen sind laut Studie längst nicht alle Lehrkräfte gewachsen: 32 Prozent der Lehrkräfte geraten im Bundesdurchschnitt beim Einsatz digitaler Medien an ihre Grenzen. Das digitale Lehren und Lernen war nicht Teil ihrer akademischen oder praktischen Ausbildung. 58 Prozent der Lehrkräfte fühlen sich gestresst, weil sie Technikprobleme lösen mussten, statt sich um ihre Arbeitsaufgaben zu kümmern. Und 54 Prozent von ihnen erleben eine höhere Arbeitsbelastung durch die Komplexität der digitalen Technik.
Bremen hat mit Online-Schulungen für Lehrer reagiert. Trotzdem: „Die Belastung ist enorm, wenngleich der individuelle Stressfaktor natürlich abhängig von der Technikaffinität des jeweiligen Kollegen ist“, sagt Christian Dirbach. Zugenommen habe auch der Bedarf an sogenannter Kooperationszeit. „Das sind die Konferenzen, Team-Besprechungen und Gespräche mit Schülern, Eltern und Kollegen“, erläutert der Lehrer. „Dafür sind drei Stunden pro Woche angesetzt und für Pädagogische Fachkräfte sogar nur eine Stunde. Die Kooperationszeit hat sich in der Pandemie erheblich davon entfernt.“ Jede neu eingeführte Maßnahme wie Distanzunterricht, das Aufholen von Versäumten und die Digitalisierung erfordere einen deutlich höheren Bedarf an Kooperationszeit. „Ein Mehr an Kooperationszeit muss aber eine entsprechende Reduzierung der Unterrichtszeit und den Ausbau der Entlastung für alle zur Folge haben“, fordert Christian Dirbach.
Schuleinstieg ohne Feier
Wie sieht der Schulalltag in der Pandemie aus? „Ich musste letztes Jahr mit einer fünften Klasse unter Corona-Bedingungen starten. Das war schon speziell. Es fand eine Einschulung statt, aber ohne die Feierlichkeiten – also sehr reduziert und unter strengen Auflagen. All das hat das Kennenlernen schon erschwert“, sagt Ina von Boetticher, Lehrerin einer sechsten Klasse an der Oberschule Lesum. "Corona-Frust", meint sie, "kenne ich auch.“
Eine Zeitlang gab es keinen Sportunterricht. „Später im Schuljahr fand Sportunterricht mit Masken statt – belastend für die Schüler, aber den Kindern war es so wichtig, dass sie sich kaum beschwert haben.“ Ebenso fielen Ausflüge pandemiebedingt weg. Ob Klassenfahrten im Frühjahr stattfinden können, muss sich zeigen. Die Deutsch- und Sportlehrerin sagt: „Es fehlt wahnsinnig viel im Schulalltag. Der Frust ist hoch. Als wir vor den Ferien ein Museum besuchen konnten und anschließend noch ein Picknick veranstaltet haben, haben sich die Schüler so gefreut und waren so dankbar. Da wurde auch deutlich, dass Schule mehr ist als Lernen.“
Der Gesprächsbedarf der Kinder aus ganz unterschiedlichen Haushalten sei in der Pandemie besonders groß. „Es zeigt sich, dass Sozialarbeiter fehlen, die das auffangen“, meint auch die 42-Jährige. Die verlässlichen Strukturen von Schule seien während der Schulschließungen verloren gegangen: „Ein I-Pad macht noch kein gutes Home-Schooling.“
Immer noch technische Probleme
Darüber hinaus galt und gilt es, technische Probleme zu bewältigen. „Wir haben immer noch Räume in der Schule ohne WLAN. Und auch bei den Kindern Zuhause funktioniert die Verbindung nicht immer zuverlässig. Es trifft dabei wieder die Kinder aus bildungsfernen Schichten, die niemanden haben, der hilft, wenn es Probleme mit dem I-Pad gibt.“
Ina von Boetticher stellt fest, dass mit den neuen digitalen Geräten auch ganz neue Probleme im Unterricht auftauchen. „Ein Schüler hatte den Link zum Einloggen weitergegeben und plötzlich tauchte pornografisches Material auf. Das ist alles wahnsinnig anstrengend.“ Als sehr hilfreich hat die Lehrerin die zwischenzeitlich praktizierte Halbgruppenregelung empfunden: „Mit zwölf Kindern kann man sehr gut arbeiten, aber das ist ja keine neue Forderung der Gewerkschaft, die Klassenstärke zurück zu fahren und für mehr Personal zu sorgen.“
Und wie groß ist der Corona-Frust bei den Schülern? Frustrierend sei es vor allem, seit mehr als zwei Jahren fast kein Sozialleben mehr zu haben, meint Lukas Strutz, Schülersprecher am Gymnasium Vegesack. Vor Corona hätten seine Mitschüler und er viele Hobbys gehabt. Jetzt fiel auch noch die Klassenfahrt aus. Trotz des Ausnahmezustands liefe in Schule jedoch vieles "sehr gut", urteilt der Elftklässler.
Für Schüler fehlt die Planbarkeit
"Zu Beginn der Pandemie war das größte Problem die Chancenungleichheit: Nicht in allen Familien konnten Eltern unterstützen und nicht jeder hatte die nötige Technik für Onlineunterricht. Hier haben Hilfen wie die Schüler-I-Pads für alle sehr geholfen." Bei all dem, was gut liefe, bleibe die Unwissenheit weiterhin ein großes Problem. "Werden die Schulen wieder geschlossen?", fragt sich der Elftklässler. "Es fehlt die Planbarkeit. Politische Entscheidungen werden kurzfristig getroffen. Fördermittel aus zum Beispiel dem Digitalpakt werden zu langsam bereitgestellt. Die Organisation muss besser werden."