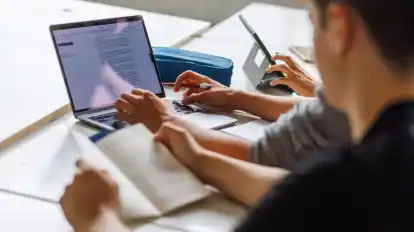Als Marc Grohnert auf die Unterrichtsstunde zurückblickt, sagt er: "Ohne Arbeiten mit künstlicher Intelligenz wären die Schülerinnen und Schüler heute nicht so ambitioniert gewesen." Eine Stunde zuvor in einem Biologieraum im Gymnasium Vegesack: Lehrer Grohnert, der auch Mitglied der Schulleitung ist, teilt im Biologie-Leistungskurs der Qualifikationsphase 2 (Q2) zwei Zettel aus. Auf einem stehen Aufgaben zum heutigen Thema Neurobiologie, auf dem anderen ist ein QR-Code abgedruckt. Mit ihren Schultablets gelangen die Jugendlichen so auf das Internetportal Fobizz, auf diesem werden sie ihre Aufgaben mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) lösen. Und das funktioniert so: Die Mädchen und Jungen tippen ihre Antworten auf die Fragen des Arbeitsblattes in das KI-Tool ein. Die Schüler können dem virtuellen Avatar auch Fragen stellen, wenn sie zum Beispiel einen Begriff nicht kennen. Am Schluss gibt ihnen die künstliche Intelligenz ein persönliches Feedback: Was ist bereits gelungen? Welche Inhalte fehlen? Dann schlägt die KI genau vor, was der Schüler verbessern soll. Die überarbeiteten Antworten werden erneut überprüft.
Im Gegensatz zu anderen KI-Tools wie ChatGPT zieht diese künstliche Intelligenz ihre Informationen nicht aus dem Internet. Grohnert hatte die KI mit Informationen gefüttert, die für die zwei Aufgaben notwendig waren, und eingestellt, wie die Rückmeldung ausschaut. In der Fachsprache heißt das "prompten". Die künstliche Intelligenz kann deshalb nicht alle Fragen beantworten. So wollte eine Schülerin wissen, wie man sogenannte postsynaptische Potenziale verrechnet. Hier musste ihr Lehrer Grohnert weiterhelfen. Wie gut die Schüler die Aufgabe gelöst haben, können sie an einer Prozentzahl sehen. "Das stachelt die Schüler an", zeigt sich Grohner überzeugt, sagt aber auch: "Aber die Prozentzahl ist sehr ungenau, daraus kann ich keine pädagogische Note ableiten."

Die Schüler bekommen von der KI ein persönliches Feedback.
In diesem Kurs hat der Biologie-, Informatik-, und Deutschlehrer den KI-Assistenten nun zum zweiten Mal eingesetzt, in anderen Klassen aber auch noch nicht häufig. "Für mich wäre eine Stunde ohne KI-Assistenz einfacher", so Grohnert. Den Zugang zu dem Tool hat er von einem Kollegen aus Bremerhaven erhalten, das Gymnasium Vegesack stellt es noch nicht offiziell zur Verfügung. "Ich würde es überall einsetzen. Bei den Kleinen muss man aber aufpassen, ob sie wirklich daran arbeiten und nicht am Tablet spielen", sagt die Lehrkraft.
Das Land Bremen gestattet ausdrücklich, KI-Tools im Unterricht anzuwenden, teilt Pressesprecherin Patricia Brandt mit. "Wichtig ist, auf die Eingabe personenbezogener Daten zu verzichten", erläutert die Pressesprecherin der Bildungssenatorin. Laut der Behörde kann KI vielseitig eingesetzt werden – etwa um den Unterricht vorzubereiten, Lernmaterialien an individuelle Bedürfnisse anzupassen oder Themen zu recherchieren und zusammenfassen. "Dabei ist es wichtig, die Grenzen der Technologie zu thematisieren", stellt Brandt klar. Wie sie weiter ausführt, können Chatbots auch vorher definierte historische Personen verkörpern, damit die Schüler mit diesen ins Gespräch kommen. "Ich ermutige meine Schüler immer, KI zu benutzen. Sie sollen sinnvoll damit arbeiten können", sagt Grohnert. Auf den Schüler-Tablets des Gymnasiums sind KI-Tools auch nicht gesperrt.
Doch wie wird verhindert, dass die Schüler KI als Hilfe für Leistungsnachweise nutzen? Schreiben Kinder und Jugendlichen eine schriftliche Prüfung, und das tun sie immer noch auf Papier, müssen sie laut Grohnert alle Mobilgeräte abgeben. Bei einem Referat bewertet Grohner auch, wie der Schüler auftritt. "Ich merke, ob jemand das Thema kann. Und stelle gegebenenfalls Rückfragen." Brandt schreibt hierzu: "Grundsätzlich gilt, dass Schülerinnen und Schüler ihre schulischen Leistungen eigenständig erbringen müssen. Lehrkräfte können den Einsatz von KI-Tools allerdings je nach Aufgabe explizit gestatten." Das müsse aber immer angegeben werden. Mit sogenannten KI-Detektoren können die Lehrer auch überprüfen lassen, ob der Schüler zum Beispiel einen Text mithilfe künstlicher Intelligenz geschrieben habe. Diese funktionieren aber nicht zuverlässig, so Brandt. Die Bildungsministerkonferenz hat Ende 2024 mehrere Handlungsempfehlungen zum Umgang mit KI beschlossen. Demnach sollen alle Schüler lernen, mit KI umzugehen. Auch die Lehrkräfte sollen im Bereich KI ausgebildet werden.
Zurück nach Vegesack: Wie erging es den Schülern mit dem Einsatz von KI? "Ich finde sie hilfreich, weil sie sich individuell auf meinen Text bezieht", sagt Sema, schränkt aber ein: "Wenn es ein Lehrer sagt, ist es persönlicher." Ihre Klassenkameradin Ena merkt an: "Der Lehrer hat nicht immer die Möglichkeit, jedem Schüler ein Feedback zu geben." Juliano bezweifelt, ob auch schon jüngere Schüler dem Einsatz von KI gewachsen seien. "Die Aufgaben müssen wir schon selber machen, damit die KI sie verbessern kann." Übrigens: Auch Lehrer Grohner selbst hat die Technologie genutzt und sich von ihr für den Unterrichtseinstieg inspirieren lassen.