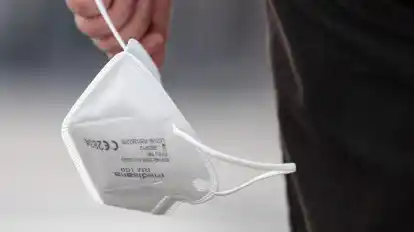- Was zeigen die Bremer Abwasser-Proben?
- Wie funktionieren Probenentnahme und Laboranalyse?
- Wie groß ist das Einzugsgebiet in Bremen?
- Was sind die Vorteile der Abwasseranalyse?
- Nutzt Bremen die Abwasserdaten für ein eigenes Frühwarnsystem?
- Das bundesweite Projekt läuft Anfang März aus – wie geht es weiter?
"Jetzt geht es los", sagt Klaus Reichelt und zeigt auf den transparenten Trichter, in den eine trübe Brühe gepumpt wird. Über einen Schlauch wird sie weitergeleitet und läuft schließlich aus einem Hahn in einen großen Kunststoffbehälter. Bei der Brühe handelt es sich um Abwasser. Reichelt ist Laborleiter bei Hansewasser, Betreiber der beiden Bremer Kläranlagen und des Kanalnetzes. Seit Februar vergangenen Jahres werden im Klärwerk Seehausen Proben für einen besonderen Zweck abgezapft: Das Abwasser wird regelmäßig auf Coronaviren untersucht.
Bremen gehört einem bundesweiten Forschungsprojekt zur Überwachung von Sars-Cov-2 und seinen Varianten im Abwasser an. Die EU-Kommission hatte die Mitgliedsstaaten aufgerufen, solche Strukturen aufzubauen – um das Infektionsgeschehen besser überwachen und Ausbrüche frühzeitiger erkennen zu können.
Seit Mitte Oktober fließen die Abwasser-Analysen in das Pandemieradar des Robert Koch-Instituts (RKI) ein – neben Daten wie der Sieben-Tage-Inzidenz oder der Hospitalisierungsrate. Die Probenergebnisse der Standorte werden außerdem im donnerstags erscheinenden Bericht des Instituts veröffentlicht: Im wöchentlichen Verlauf soll daran abzulesen sein, in welchen Regionen die Viruslast im Abwasser ansteigend, fallend oder gleichbleibend ist. Aktuell umfasst die Übersicht die Trends von bundesweit 48 Kläranlagen – die Anzahl der Standorte ist nach und nach erweitert worden.
Was zeigen die Bremer Abwasser-Proben?
"Wir befinden uns in einer sinkenden Welle", sagt Christoph Bernatzky, Leiter Technologie und Innovation bei Hansewasser. "Die Viruslast im Abwasser nimmt ab." Diese Entwicklung habe sich bei der jüngsten Probe von Mittwoch, 11. Januar, bestätigt. Im Wochenbericht des RKI wird der Bremer Trend nur bis Jahresende angezeigt – zuletzt mit dem Merkmal "ansteigend". Die RKI-Übersicht ist beim Großteil der Standorte seit Jahresende lückenhaft. Die RKI-Berechnung berücksichtigt unter anderem Kriterien wie wetterbedingte Schwankungen, wie es in dem Bericht heißt. "Das Labor, in dem die Bremer Proben analysiert werden, liefert die reinen Ergebnisse auch direkt an uns", sagt Bernatzky. "Daher können wir die Entwicklung Woche für Woche nachvollziehen und vergleichen."
Wie funktionieren Probenentnahme und Laboranalyse?
Immer montags und mittwochs werden die Abwasserproben im Klärwerk Seehausen abgezapft. "Das geschieht jeweils über 24 Stunden, von 0 bis 24 Uhr", erklärt Bernatzky. Viele Male in diesem Zeitraum wird die automatisierte Probenentnahme in Gang gesetzt. Um 6 Uhr morgens wird der Behälter mit dem gesammelten Abwasser entnommen und zunächst "homogenisiert" – geschüttelt, damit sich abgesetzte Bestandteile gleichmäßig in der Flüssigkeit verteilen. Die Abwasserprobe wird schließlich aus dem Kanister in mehrere Behälter abgefüllt. "Nicht nur die Corona-Viruslast wird untersucht, die regelmäßige Beprobung des Abwassers ist ein Standardverfahren", erklärt Laborleiter Reichelt. 500 Milliliter Seehauser Abwasser werden für die Corona-Analyse an ein Karlsruher Labor geschickt. "Mithilfe molekularbiologischer Methoden können Genfragmente des Virus nachgewiesen werden. Alle sechs Wochen werden mit einem weiteren Verfahren Virusvarianten bestimmt."
Wie groß ist das Einzugsgebiet in Bremen?
Das Abwasser in der Kläranlage Seehausen kommt nicht nur aus dem stadtbremischen Gebiet bis etwa St. Magnus, sondern auch aus Lilienthal, Stuhr, Weyhe und Ritterhude. "Das entspricht einer Zahl von etwa 600.000 Einwohnern", sagt Bernatzky.
Was sind die Vorteile der Abwasseranalyse?
"Mehrere Tage im Voraus kann im Abwasser der Anstieg der Viruslast erkannt werden", sagt der Hansewasser-Experte. Bruchstücke des Coronavirus gelangten über Ausscheidungen wie Stuhl, Urin und Speichel ins Abwasser, dies sei deutlich früher als ein Test. Dazu komme: Nicht jeder lasse sich testen, künftig werde die Anzahl Corona-Tests noch weiter abnehmen. "Jeder muss aber zur Toilette", betont Bernatzky. "Mit dem Abwasser ist man damit näher am tatsächlichen Infektionsgeschehen." Wie nah, zeigt ein Kurvenverlauf, den Hansewasser aus den Labordaten seit Projektbeginn erstellt hat: Die Anstiege der Viruslast im Seehauser Abwasser entsprechen danach dem Verlauf der Sieben-Tage-Inzidenz in Bremen. Zu sehen ist dies etwa bei Infektionswellen im Sommer und Mitte Oktober. "Die Kurven liegen relativ gut übereinander", sagt Bernatzky. "Es funktioniert. Abwasser lügt nicht."
Nutzt Bremen die Abwasserdaten für ein eigenes Frühwarnsystem?
"Die Veröffentlichung und Bewertung der Daten obliegt im Moment dem RKI", sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde. "Derzeit läuft noch die Projektphase, die Ergebnisse sind laut RKI noch nicht repräsentativ. Das Verfahren muss sich erst etablieren, sodass es verlässlich und auch regional genutzt werden könnte." In anderen Ländern Europas ist ein Abwassermonitoring schon länger Standard – nicht nur für Corona. In Großbritannien und im US-Staat New York wurden zuletzt Polio-Viren nachgewiesen, woraufhin die Behörden zum Impfen aufriefen.
Das bundesweite Projekt läuft Anfang März aus – wie geht es weiter?
Laut RKI soll es im Frühjahr Empfehlungen geben, wie ein Frühwarnsystem auf Basis von Abwasseranalysen aussehen könnte. Laut Hansewasser werden die EU-Fördermittel bereits Ende Januar ausgeschöpft sein. "Das Bundesgesundheitsministerium hat Interesse daran, dass es weiter geht. Wir werden über diesen Zeitrahmen hinaus liefern", so Bernatzky.