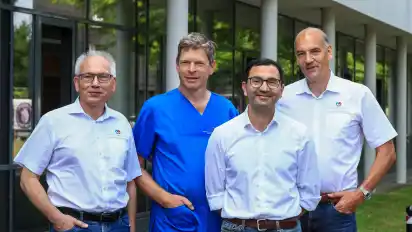Herr Woggan, warum senken Sie mitten im Jahr die Beiträge und nicht wie sonst üblich zum Jahreswechsel?
Olaf Woggan: Wir haben 2022 mehr eingenommen als geplant und weniger ausgegeben. Das zeigt unser Jahresabschluss vom vergangenen Jahr. Im Nachhinein betrachtet: Eigentlich war unser Zusatzbeitrag zu hoch. Das kann man nicht mehr zurückholen. Deshalb: So weit wir das Jahr 2023 überblicken können, wird sich diese Entwicklung so fortsetzen.
Ist das so?
Wir haben weiterhin leicht sinkende Ausgaben, während sich die Einnahmen positiv entwickeln. Wir hätten also Vermögen aufgebaut, das wir gar nicht haben wollen. Also haben wir die Senkung des Beitragssatzes bereits jetzt entschieden und nicht erst zum Jahresende.

Olaf Woggan, Vorstandsvorsitzender der AOK Bremen/Bremerhaven, sieht die finanzielle Entwicklung der Krankenkasse so gut, dass zum Oktober die Beiträge sinken sollen.
Sind Ihre Mitglieder und Versicherten alle so gesund, oder wie ist das zu erklären?
Wir haben auf der einen Seite viele kranke und sehr kranke Mitglieder und Versicherte, und das wird auch immer so bleiben. Tatsächlich hat aber in den vergangenen Jahren die Zahl der Gesunden mehr zugenommen als die der Kranken. Viele jüngere Menschen haben uns gewählt, dagegen kommen die hochaltrigen Rentner langsam an ihr Lebensende. Viele der jungen Versicherten sind durch Zuwanderung zu uns gekommen. Von den 9000 neuen Mitgliedern im vergangenen Jahr entfallen 7000 auf die Zuwanderung – und die kommen nicht nur aus der Ukraine.
Und der Rest?
Wir haben viele Menschen aus der Bremer Bevölkerung hinzugewonnen, weil wir in den Lebens- und Sozialbereichen präsent sind, in denen junge Familien unterwegs sind. Das wirkt alles leistungsdämpfend. Außerdem haben sich unsere Einnahmen stabilisiert und laufen besser, als wir angenommen haben.
Da machen Sie ja nun genau das Gegenteil von dem, was Bundesgesundheitsminister Lauterbach prophezeit hat. Der geht für 2024 von steigenden Beiträgen von bis zu 0,4 Prozentpunkten aus.
Das Jahr 2024 vorauszusagen ist sehr schwierig. Aber wir werden das Jahr wohl aus den Überschüssen der ersten drei Quartale 2023 mitfinanzieren, die wir jetzt noch erzielen werden. 2024 wird für uns dann wohl zu einer negativen Bilanz führen. Das ist nicht schlimm, denn wir wollen unsere Konten nicht mit Vermögen anhäufen, sondern das Geld im Umlauf lassen. Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn hatte ja schon deutlich gemacht, dass Rücklagenbildung bei Krankenkassen nicht erwünscht ist.
Im Rückblick auf alle Fälle.
Es ist im Augenblick sehr anspruchsvoll vorauszusagen, wie sich die Ausgaben im Gesundheitsbereich in den kommenden Jahren entwickeln werden. Denn diejenigen, die krank sind, sind momentan latent ja eher unterversorgt.
Spielen Sie damit auch auf die Situation bei Bremens Gesundheit Nord an?
Ja, wenn sich die Geno um ein ganzes Krankenhaus verkleinern will, macht sie das ja aufgrund der bestehenden Situation. Sie kann ihre Kapazitäten mit dem vorhandenen Personal gar nicht mehr richtig bewirtschaften. Wenn es weniger Kapazitäten gibt, gibt es auch weniger Behandlungsfälle und am Ende auch weniger Ausgaben für die Krankenkassen.
Wie sehen Sie also die Pläne zum Krankenhaus Links der Weser?
Dieser Schritt ist in diesem Zusammenhang unausweichlich. Wir können nicht mehr Krankenhäuser betreiben, die nicht mal mehr ihre Mindestpersonalvorhaltung erfüllen können. Also lieber drei Standorte, die man gut auslastet, statt vier Standorte, die nur halbherzig betrieben werden. Dieser Prozess, dass Krankenhausleistungen zentralisiert werden, wird nicht nur die Geno treffen, sondern alle Krankenhausträger in Bremen und Bremerhaven.
In der Tat.
Es wird auch für die Zukunft wichtig sein, die lebenswichtige Versorgung, also zum Beispiel Krankenhäuser und auch niedergelassene Ärzte, für die Menschen verfügbar zu haben. In der Summe gibt es aber die Tendenz, dass diese Versorgung nicht mehr in dem bisherigen Umfang zur Verfügung steht. Ob Herr Lauterbach und sein Ministerium das alles so richtig bewerten für 2024, da bin ich mir nicht sicher.
Was lässt Sie bei Herrn Lauterbach noch mit dem Kopf schütteln?
Er könnte zu der Frage nach der Finanzierung nun mal endlich "Butter bei die Fische" geben. Wir warten schon lange auf einen Gesetzentwurf, der die Finanzierung für das kommende Jahr regelt. Er redet immer darüber, aber es kommt nichts. Das ist für uns als Krankenkasse eine unbefriedigende Situation.
Bei welchen Projekten können Sie dem Bundesgesundheitsminister beipflichten?
Sein Ministerium hat gerade zwei Gesetzentwürfe vorgelegt. Bei dem einen geht es um die Gesundheitskioske und die Bündelung primärärztlicher Versorgung in tendenziell unterversorgten Gebieten. Es ist richtig, dass das kommt, wir stehen als AOK voll dahinter. Wir haben das in Gröpelingen mit dem Projekt "Liga" auch schon mal vorgedacht. Dort können wir durch das Gesetz dann einen Gesundheitskiosk eröffnen.
Und dann ist da noch die elektronische Patientenakte.
Wir haben uns wie andere Krankenkassen auch viel Mühe gegeben, dass es eine gute Patientenakte wird. Dass sie momentan nur von sehr wenigen Menschen genutzt wird, stellt uns nicht zufrieden. Unser Aufwand wird sich erst lohnen, wenn ein Großteil der Versicherten diese Patientenakte auch nutzt. Deshalb ist der Ansatz gut, dass nun alle diese Akte bekommen, wenn sie nicht ausdrücklich widersprechen.
Warum tut sich Deutschland im Gesundheitsbereich so schwer mit der Digitalisierung?
Es liegt ganz bestimmt nicht an dem Aufwand, den wir dafür betreiben. Der ist eher groß, wir machen es uns aber mit den einzelnen Lösungen sehr schwer. Das liegt auch daran, dass wir es im Einzelfall immer besonders gut machen wollen. Hinzu kommt, dass es durch die Rahmenbedingungen des Datenschutzes nicht selten kompliziert ist. Angesichts des Datenangriffs auf die Geno und die Krankenkassen ist das ein sensibles Thema.
Wie hat sich die Einführung der elektronischen Bescheinigung für Arbeitsunfähigkeit seit Jahresanfang entwickelt?
Der Prozess läuft inzwischen zu 99,9 Prozent gut. Das ist ein positives Beispiel für die Digitalisierung in Deutschland. Ob die Arbeitgeber mit diesem neuen Verfahren rundum glücklich sind, wissen wir noch nicht. Von unserer Seite her funktioniert es.
Die Pandemie ist vorbei und damit wohl auch die Zeit, als jedes Krankenhaus zu Beginn jeden Patienten auf Corona getestet hat. Inwiefern würden Sie es begrüßen, wenn nun jeder Patient bei der Einlieferung auf multiresistente Keime getestet wird?
Das wäre zu begrüßen. Wir haben vor Jahren bereits mit dem Rotes-Kreuz-Krankenhaus einen Modellversuch gestartet. Nicht ganz einfach ist das bei den Notfällen, wenn Patienten mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dann steht natürlich die Lebensrettung im Vordergrund. Aber bei den geplanten Operationen wird das im Rotes-Kreuz-Krankenhaus mit Erfolg angewendet. Das Thema ist leider etwas untergegangen.
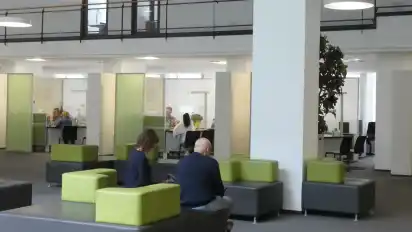
Der Beratungsbereich bei der AOK Bremen/Bremerhaven in der Verwaltungszentrale an der Bürgermeister-Smidt-Straße.
Letztes Jahr war ja noch Pandemie. Wie hat sich ihre Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" denn entwickelt?
Die Aktion läuft ja schon seit 2004 in jedem Sommer, wir haben jedes Jahr auch fahrradaktive Betriebe ausgezeichnet. Dieses Jahr werden wohl wieder mehr als 7000 Menschen mitmachen. Gleichzeitig bedauern wir es, dass immer noch zu viele Fahrradfahrer ohne Helm unterwegs sind. Wir versuchen mit einer Helmkampagne, mehr Menschen vom Helmtragen zu überzeugen. Denn wer schon bei normaler Fahrt ohne Helm mit dem Kopf auf den Kantstein fällt, kann für den Rest seines Lebens geschädigt sein.