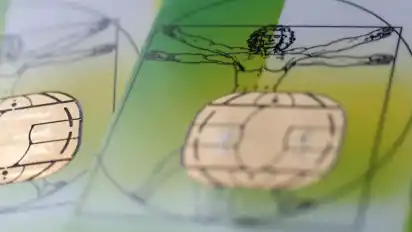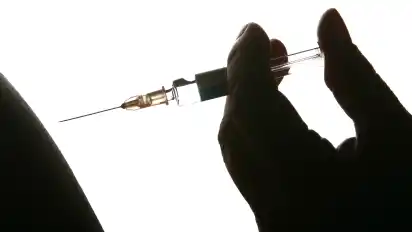Herr Lempe, Sie haben die HKK im letzten Jahr ganz schön heruntergewirtschaftet angesichts eines Minus von 222 Millionen Euro – wie erklären Sie das?
Tatsächlich lag die Finanzlücke bei uns und allen anderen Krankenkassen – insgesamt minus 6,8 Milliarden Euro – vor allem an der gesetzlichen Zwangsverpflichtung, Rücklagen aus Beitragsgeldern in Höhe von 8 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds abzuführen. Das hat die Kassen deutlich ärmer gemacht und ihre Tragfähigkeit für künftige Kostensteigerungen eingeschränkt. Daher ist für 2023 ein Finanzloch von insgesamt mindestens 17 Milliarden Euro prognostiziert.
Bedeutet das für HKK-Mitglieder in Zukunft weniger Leistung?
Keinesfalls: Die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen will Herr Lauterbach (Bundesgesundheitsminister, d. Red.) ja nicht reduzieren. Die machen den Großteil der Leistungen aus, sodass es zwischen den Kassen nur am Rande Unterschiede gibt. Aber auch da schneiden wir in Kassentests regelmäßig sehr gut ab.
Bisher hinterließ der neue Bundesgesundheitsminister den Eindruck, dass er vor lauter Corona das Thema Krankenkassen vor sich herschiebt. Nun hat er erste Vorschläge vorgelegt.
Ja, eine politische Lösung für die Finanzprobleme der Kassen ist seit Monaten überfällig. Am Dienstag gab es endlich erste Aussagen des Ministers, allerdings noch immer keinen Gesetzentwurf. Nun soll also die mindestens 17 Milliarden Euro große Finanzlücke mit einem Bündel von Maßnahmen geschlossen werden: So wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Krankenkassen um 0,3 Prozentpunkte erhöht – das bringt bis zu fünf Milliarden. Dazu soll ein erhöhter Steuerzuschuss von zwei Milliarden kommen, ergänzt um ein Bundesdarlehen an die Krankenkassen in Höhe von einer Milliarde Euro. Um die restlichen, mindestens noch fehlenden neun Milliarden auszugleichen, will Herr Lauterbach Effizienzreserven in Höhe von drei Milliarden Euro bei der Pharmabranche, Arzthonoraren und stationären Pflegekosten heben. Für den Rest sollen nun auch die letzten Reserven der Kassen und des Gesundheitsfonds bis auf ein Minimum verbraucht werden.
Wie bewerten Sie diese Pläne der Bundesregierung?
Ich bin enttäuscht, weil es erneut ein inakzeptabler Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen ist. Vor allem aber ist es nur eine Kurzfristlösung für 2023 und nicht einmal für den Rest der Legislaturperiode tragfähig. Das gesamte System wird dadurch krisenanfälliger. Außerdem tragen die Beitragszahler über Zusatzbeiträge und Vermögensabschöpfungen mit mehr als zwölf Milliarden Euro die Hauptlast, während die großen Strukturprobleme etwa im Krankenhausbereich ungelöst bleiben. Eine stabile Finanzierungsgrundlage hätte man erreichen können, indem man die Mehrwertsteuer für Arzneimittel und Hilfsmittel auf den ermäßigten Steuersatz absenkt. Das hätte schon mal sechs der fehlenden 17 Milliarden Euro gebracht. Außerdem zahlt der Staat den Kassen bisher nur ein Drittel der tatsächlich anfallenden Kosten für Hartz-IV-Empfänger. Wäre es der volle Betrag, kämen weitere zehn Milliarden Euro zusammen.
Wie wirkt das mit der Inflation und den Beiträgen für die anderen Sozialversicherungen zusammen?
Die steigenden Kassen-Zusatzbeiträge kommen Anfang 2023 zeitgleich mit der jetzt schon überfälligen Erhöhung der Beiträge für die Pflegeversicherung: Die liegen momentan bei 3,05 Prozent für diejenigen, die Kinder haben, für den Rest ist es etwas mehr. Da kommen wahrscheinlich 0,35 Prozent drauf. Dazu kommt noch die absehbare Erhöhung der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf dann 2,6 Prozent. Somit droht in der gesamten Sozialversicherung ein Beitragshammer, der sich direkt an den aktuellen Inflationsschock anschließt.
Wo bei der Arbeit von Herrn Lauterbach lässt sich erkennen, dass er Mediziner ist und von der Materie eigentlich Ahnung haben sollte?
Aus meiner Sicht ist er momentan in erster Linie ein Ankündigungsminister. Zum Beispiel kann man trotz seiner Ankündigungen kaum erkennen, dass er das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen konkret aufgreift: Bisher haben wir kein neues Gesetz bekommen. Dagegen ist er in Talkshows und auf Twitter sehr präsent. Der Spagat zwischen dem öffentlichen Erklären von wissenschaftlichen Studien und der Führung des Ministeriums fällt ihm offensichtlich schwer. Ich hoffe, dass der Betrieb in seinem Ministerium nun Fahrt aufnimmt - auch jenseits der vordringlichen Corona-Politik.
Bei der elektronischen Gesundheitskarte und dem elektronischen Rezept macht es gefühlt den Eindruck, dass es auch da nicht vorangeht. Wie sehen Sie das?
So ist es auch. Es wäre wichtig, jetzt schnell das elektronische Rezept zu realisieren, angesichts von 500 Millionen Rezepten jährlich. Das geschieht nun mit zeitlicher Verzögerung, sodass es sich immerhin im kommenden Jahr durchsetzen wird. Nun muss auch die elektronische Patientenakte, kurz ePA, auf den Weg kommen. Für die ePA braucht es eine digitale Identität für jeden Versicherten in Form einer Nummer. Die muss noch erzeugt werden, und das stockt gerade. Man darf nicht vergessen: Die elektronische Patientenakte kann Leben retten. Mit ihr kann beispielsweise auf einen Notfalldatensatz zugegriffen werden, der Blutgruppe, Unverträglichkeiten, Schwerbehinderung und verordnete Medikamente anzeigt.
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Spahn sagte einst bezogen auf die Pandemie „Wir werden hinterher einander viel verzeihen müssen“. Was können Sie dem Minister nur schwer verzeihen?
Meines Erachtens war es ordnungspolitisch verfehlt, die Krankenkassen zur radikalen Abführung ihrer Rücklagen zu zwingen. Nun ist wie gesagt sogar absehbar, dass es zu einer zweiten Runde der Zwangsabführung angesparter Beitragsgelder kommt. Das führt dazu, dass momentan jede Kasse ihre Finanzlage schlecht rechnet, um diese nächste Runde mit möglichst wenig Blessuren zu überstehen. Gleichzeitig sieht man, dass der Markt sich konsolidiert: Es gibt jetzt erstmals weniger als 100 Krankenkassen.
Die Zahl der Mitglieder und Versicherten wächst bei der HKK stetig – auch weil Sie die günstigste Krankenkasse sind. Welche Standortvorteile sehen Sie, wenn man als Krankenkasse in Bremen sitzt?
Wir haben letztes Jahr weitere 143.000 Versicherte hinzubekommen – auf unsere Größe bezogen also 20 Prozent mehr. Auch in dem künftig schwierigeren Umfeld werden wir attraktiv positioniert bleiben und wachsen. Zusammen mit der AOK Bremen und der BKK Firmus stellt Bremen durchaus einen bedeutsamen Standort für Krankenkassen dar. Zu den Bremer Standortvorteilen zählt, dass wir hier günstige Mieten zahlen und einen noch halbwegs intakten Arbeitsmarkt haben. Dennoch bekommen wir langsam Probleme, unsere aktuell 80 bis 100 vakanten Stellen zu besetzen. Angesichts unseres Wachstums müssen wir natürlich sicherstellen, dass unsere Servicequalität erhalten bleibt. Aber wir profitieren auch vom Rückbau des Bankensektors in der Region und konnten dadurch viele Quereinsteiger für uns gewinnen. Insgesamt haben wir in den vergangenen fünf Jahren 400 Vollzeitstellen zusätzlich aufgebaut.
Wie unbeliebt ist die HKK bei Krankenhäusern eigentlich, wenn ihre Leistungsabteilung bei Abrechnungen genauer hinschaut, als das vielleicht andere Kassen machen?
Das ist schwer zu beurteilen. Wir kontrollieren die Abrechnungen aus den Krankenhäusern sehr konsequent, der Gesetzgeber erlaubt das aber nur noch bei einem kleinen Teil der Rechnungen. Von dem, was wir überprüfen, erweist sich jede zweite Rechnung als korrekturbedürftig. Dadurch ergibt sich für die HKK jedes Jahr eine Rückforderung in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages.
Momentan haben wir in Bremen zehn Kliniken: Vier städtische, vier in freier Trägerschaft und zwei private – wie viele Krankenhäuser wird Bremen in zehn Jahren noch haben?
Es wird dann sicherlich Mischformen geben, bei denen die stationäre und die ambulante Versorgung stärker ineinander übergreifen. Allerdings sollte man als Bürger darauf achten, wie es in Bremen mit der Landeskrankenhausplanung weitergeht. Gesundheitssenatorin Bernhard hat zwar ein erfolgreiches Corona-Krisenmanagement betrieben. Bei der Krankenhausplanung orientiert sie sich aber leider nicht an den Best-Practice-Ansätzen aus anderen Bundesländern, vor allem bei der Beseitigung überflüssiger Doppel- und Dreifachstrukturen. Zum Beispiel können Sie in Bremen in fünf Kliniken ein neues Knie bekommen. Dieses Überangebot kann dazu führen, dass in anderen Bereichen die Pflegeressourcen so knapp sind, dass Betten gesperrt werden müssen – zum Beispiel in der Stroke Unit, also dem Bereich für Schlaganfälle, der ja lebensrettend ist.
Und wie viele Krankenkassen wird es in Deutschland in zehn Jahren noch geben?
Die Staatsnähe des Systems steigt, je mehr Steuergelder hineingepumpt werden. Insofern gibt es die Tendenz, das System zu vereinheitlichen. Ich gehe von maximal 30 Krankenkassen aus, die es dann noch geben wird – und bin überzeugt, dass die HKK eine davon sein wird.
Mit wie vielen Beschäftigten rechnen sie in den kommenden Jahren? In der Privatwirtschaft würde man sich die Frage stellen, ob das nicht ein zu rasantes Wachstum wäre.
Das ist in der Tat eine Herausforderung für uns, auch wenn wir in diesem Jahr voraussichtlich „nur“ um sechs Prozent wachsen werden, was 50.000 Versicherten entspricht. Das sind immer noch mehr Menschen, als das Weserstadion fasst. Sobald sich in einem Gesetzentwurf konkreter abzeichnet, wie sich der Kassenwettbewerb entwickelt, werden wir uns um zusätzliche Beschäftigte bemühen, um auf einen möglichen Ansturm neuer Mitglieder zum Jahresanfang vorbereitet zu sein.
Angesichts dieses Wachstums und den – verglichen mit anderen Kassen – niedrigeren Beiträgen: Wie schauen die anderen auf Sie? Werden Sie beim Jahrestreffen der Kassen immer an den Katzentisch gesetzt?
Es ist schon so, dass man kritisch beäugt wird. Im Zweifel geht es auch ein wenig in Richtung Neid. Die Top-Leute versuchen es, sportlich zu nehmen, aber die großen Vertriebsstäbe anderer Kassen machen wir durchaus etwas kirre.
Bei den jungen Menschen scheint das Thema Krankenkasse angekommen zu sein: Seit Jahren haben Sie keine Probleme, Ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, während bei den Banken immer mehr Plätze unbesetzt bleiben. Was ist das Spannende an einer Krankenkasse?
Es ist die Vielfältigkeit. Wir haben hier nicht nur Verwaltungstätigkeiten, sondern mit der gesamten Gesundheitswirtschaft zu tun. Das ist ein spannendes Geschäft, in das wir alle möglichen neuen Berufsfelder integrieren. So haben wir mehr und mehr Stäbe mit Medizinern, Gesundheitsfachleuten oder Statistikern. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen fordert ständig unsere Innovationsfähigkeit. Hier wird es in den kommenden Jahren spannend, und bei uns kann man das von innen heraus mitgestalten.