Die ersten Patienten sind im Mai 2019 eingezogen, fünf Jahre später als geplant. Pleiten, Pech und Pannen hatten für die Verzögerung gesorgt. Voll in Betrieb ging der Neubau des Klinikum-Mitte im Herbst 2019. Nach zwei Jahren zieht der WESER-KURIER eine Bilanz: Was ist besonders gut geworden, was eher mittelmäßig, und woran hapert es noch? Rundgang durch ein Krankenhaus, das 25 Fachkliniken unter einem Dach vereint, die vorher auf dem Gelände am Hulsberg verteilt waren.
Die Notaufnahme
Judith Gal ist die Ruhe in Person und muss das als Chefin der Notaufnahme auch sein. Sie wartet geduldig am Eingang, in Regen und Kälte, bis eine Viertelstunde verspätet endlich die Journalisten kommen. Ihnen kann die Chefärztin nun erklären, was mit dem Neubau in ihrer Abteilung anders geworden ist, und dazu gehört zunächst die Zufahrt. Sie ist verlegt worden und darf nur noch von Rettungswagen benutzt werden. Es gibt mehr Platz, mehr Manövrierfähigkeit. Außerdem wird an diesem Beispiel bereits deutlich, worum es beim Neubau in erster Linie geht: Zentralisierung. In die Notaufnahme kommen jetzt neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche. Sie waren auf dem Klinikgelände vorher woanders hingebracht worden.
Ein paar Meter hinein, zu den sogenannten Schockräumen, vier an der Zahl, in denen die Patienten zunächst versorgt werden. Operiert wird eine Etage höher. „Die kurzen Wege sind unschlagbar“, sagt Gal. Bis auf die OPs kann hier alles, was an Untersuchung und Behandlung notwendig ist, erledigt werden, auch die Computertomografie. Früher gab es dafür verschiedene Orte. „Das Rundum-Paket“, sagt die 42-Jährige.
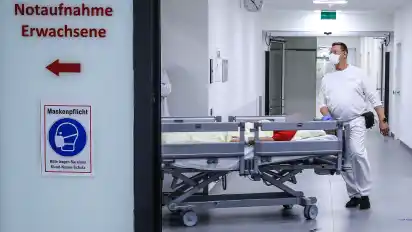
In die Notaufnahme kommen jetzt neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche.
Zur Notaufnahme gehört auch die Beobachtungsstation für Patienten, bei denen die Diagnose nicht ganz klar ist, die in der Regel aber schnell wieder nach Hause gehen. Sechs Zimmer, alle unbesetzt. Warum? „Personalmangel“, sagt Gal und gibt damit eine Antwort, die an diesem Tag häufig zu hören ist.
Die Intensivstation
Rolf Dembinski schaut ein wenig ratlos drein. Zugausfall, die Tochter kann nicht kommen, der gemeinsame Urlaub steht auf dem Spiel: „Ich habe da ein Problem.“ Dann ist er aber ganz schnell bei der Sache. Intensivstation, sein Revier, er ist der Chef. „Das ist das Beste, was der Neubau zu bieten hat“, sagt der 53-Jährige. Groß, hell, nicht so laut wie früher und mit modernster Ausstattung. „Dadurch, dass die verschiedenen Intensivstationen zusammengelegt worden sind, haben wir jetzt auf Zuruf alle medizinischen Disziplinen am Bett.“ Ein Vorteil für die Patienten, und auch für die Kollegen ein Gewinn: „So lernen wir besser voneinander.“
Die Intensivstation hat zwei Abteilungen, für die schweren Fälle die eine, für die besonders schweren die andere – je 36 Betten, insgesamt gut 20 mehr als vorher. „Wir sind auf einer Ebene mit den Operationssälen und ganz nah an der Notaufnahme“, hebt Dembinski hervor. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Konserven von der Blutbank an der Friedrich-Karl-Straße jetzt nicht mehr mit dem Taxi, sondern mit der Rohrpost kommen: „Ein echter Coup.“
Als Mangel empfindet der Klinikdirektor, dass zu wenig Stauraum da ist. Damit könnte er noch leben, „man gewöhnt sich“, nicht aber mit etwas, was Dembinski als „Katastrophe“ bezeichnet: die Not an Pflegekräften. Von 102 Planstellen sind nur 80 besetzt. Ein Drittel der Betten kann deshalb nicht belegt werden.
Das Personal auf der Station strahlt Ruhe und Konzentration aus. In einem der Krankenzimmer wird ein Corona-Patient versorgt, Menschen um ihn herum, die Schutzkleidung tragen. „Wir haben zurzeit vier solcher Fälle, alles Ungeimpfte.“ Dembinski sagt das mit einer Miene und in einem Ton, dass mehr nicht sein muss, um sein Unverständnis auszudrücken.
Die Operationssäle
Im Umkleideraum ist wenig Platz. Raus aus den Klamotten, hinein in die OP-Kluft – gar nicht so einfach, wenn ständig jemand vorbei will. Dort, wo operiert wird, in 16 Sälen, herrscht auf den Fluren davor heillose Unordnung. Kreuz und quer stehen Wagen mit medizinischem Besteck herum. Der Laie erkennt kein System, doch es gibt eines. „Wir sind damit viel flexibler“, sagt Renate Michelmann, die im OP für die Organisation und das Personal zuständig ist. Jeder Wagen ist eine Einheit, komplett ausgerüstet und spezialisiert: Urologie, HNO, Neurologie, je nachdem. Die Operateure haben gleich alles beieinander und müssen es nicht mehr aus den Schränken herauskramen lassen.
Michelmann zeigt einen Saal, der für Notfälle reserviert ist. Er ist besonders groß, damit Patienten, die mehrere Verletzungen haben, gleichzeitig unterschiedlich behandelt werden können. „So etwas hatten wir vorher nicht“, sagt die Pflegeleiterin. Neu auch, dass so viele OP-Säle auf einer Ebene vereint sind und dass es einen direkten Zugang zur Kinderklinik gibt, „ein absoluter Vorteil“, findet Michelmann. Das Miteinander aller Fachrichtungen und Abteilungen habe sich dadurch deutlich verbessert: „Wir sind zusammengewachsen“.
Ein Mann auf einem der OP-Tische, der am Kopf operiert wird. Gleißendes Licht, die beiden Ärzte wirken gelassen, sie vergewissern sich an den Monitoren, dass alles gut verläuft. Drumherum herrscht Emsigkeit, aber keine Hektik. Michelmann erzählt, dass in den Sälen bei Licht und Akustik nachgebessert werden musste. Eines aber sei nicht mehr zu ändern, bedauert sie: Im Aufwachraum für die operierten Patienten, rund 70 jeden Tag, gibt es kein Tageslicht. Eine Belastung für die Pflegerinnen und Pfleger, die dort arbeiten. „Der Pausenraum hat Fenster, das hilft“, sagt die 59-Jährige.
Die Tagesklinik
Der Flur ist lang und birst vor Kompetenz. „Hier sitzen rechts und links alle Chefärzte“, sagt Jörg Gröticke, der im Krankenhaus die Tagesklinik leitet. Wieder einer, von dem viel Lob dafür kommt, dass die Wege so kurz und alle medizinischen Disziplinen auf engem Raum versammelt sind. Auf zu engem Raum, schickt Gröticke hinterher. Die Büros für die Ärzte seien zuerst ungebührlich klein gewesen: „Wir brauchen auch ein bisschen Raum zum Denken.“ Die Planer waren offenbar zu knauserig, haben sich aber besonnen und umgebaut. Ganz zufrieden ist der Oberarzt noch nicht: „Mehr Licht in der gesamten Abteilung wäre auch schön.“
In die Tagesklinik kommen Patienten, die eine Chemotherapie benötigen, eine Bluttransfusion oder die Nachsorge nach einer Knochenmarktransplantation. Sie bleiben ein paar Stunden, erdulden, was unabänderlich ist, und gehen wieder. Ob Ultraschall, EKG, Röntgen, CT oder MRT – für jede diese Untersuchungen geht es jeweils nur um die Ecke. „Das war früher auf verschiedene Gebäude verteilt“, berichtet Gröticke. Ein bisschen Kritik, das schon, aber sonst schätzt er den Neubau und seine Kompaktheit: „Unser Alltag funktioniert sehr gut.“
Die Rohrpost
Raum 296 im Keller des Gebäudes. Hier ist der Bahnhof, in dem jeden Tag bis zu 2500 Fahrten durchgeschleust werden. Ein labyrinthisches System von Plastikrohren, in denen Büchsen unterwegs sind – die roten mit Blut beladen, die grünen mit dem Papierkram. Das ist die Rohrpost, die es im Klinikum-Mitte schon immer gab und auch im Neubau installiert wurde. Was vorher nicht da war, ist die Verbindung zwischen der Blutbank des DRK und den Abteilungen der Klinik, die auf die Konserven angewiesen sind.

Das labyrinthische Rohrpost-System im Krankenhaus.
Während Jens Koch, Technik-Chef des Krankenhauses, die Finessen der Rohrpost erklärt, flutschen fast lautlos allerhand Büchsen durch die Rohre. „Es gibt zwei Arten“, sagt Koch, „die dickeren mit dem Blut sind vier Meter pro Sekunde unterwegs, die anderen schaffen in der gleichen Zeit acht Meter.“ Die Rohrpost ist vor mehr als 150 Jahren erfunden worden, ein denkbar einfaches Prinzip – für ein komplexes Krankenhaus.






