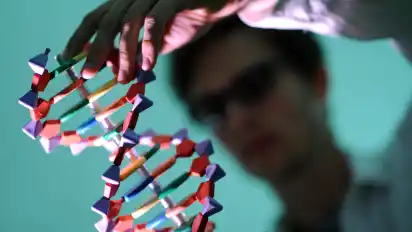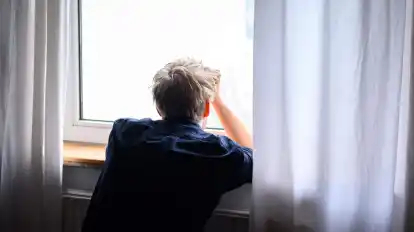Es sind zwei Fachartikel mit zusammen 19 Seiten, die von der Pflanzenzüchtung bis zur Medizinforschung für Aufsehen sorgen: Ende Juni haben Forscher im Wissenschaftsjournal „Nature“ darüber berichtet, wie ein Enzym in Bakterien bewirkt, dass DNA-Abschnitte manchmal ihre Position im Erbgut verändern. Das klingt für Laien nicht besonders aufregend. Doch in einigen Jahren könnte diese Entdeckung die Grundlage bilden, um Pflanzen in kurzer Zeit an den Klimawandel anzupassen, Erbkrankheiten zu heilen oder erdölbasierte Prozesse in der Chemie durch nachhaltige biotechnologische Alternativen zu ersetzen.
Im Jahr 2020 dürften viele Menschen das erste Mal von dem Prinzip der Genom-Editierung gehört haben. Damals erhielten die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna den Chemie-Nobelpreis, weil sie acht Jahre zuvor CRISPR/Cas9 erfunden hatten, eine Technik, mit der sich relativ einfach Stellen im Erbgut verändern lassen. Gene können damit gezielt eingefügt, entfernt, deaktiviert oder repariert werden. Zugrunde liegt dem Verfahren ein natürliches Prinzip aus Bakterien, die sich vor Viren schützen, indem sie deren DNA nach einer Infektion wieder aus ihrem Erbgut entfernen. Die Ende Juni vorgestellte Methode setzt hingegen auf sogenannte IS110-Elemente – und Fachleute halten sie für einfacher, sicherer und vielseitiger als CRISPR/Cas9.
Springende Gene als Vorbild
IS110 zählt zu den sogenannten Transposons. Umgangssprachlich spricht man auch von springenden Genen, denn bei Transposons handelt es sich um Abschnitte eines Genoms, die immer wieder dafür sorgen, dass sie aus dem Erbgut ausgeschnitten und an anderer Stelle wieder eingefügt werden. Die DNA-Sequenz eines Transposons beinhaltet dazu das Gen für ein bestimmtes Enzym, die Transposase. Hat die Zelle das Enzym erst einmal produziert, schneidet es seine eigene Gensequenz und die umliegenden Bereiche des Transposons aus dem DNA-Doppelstrang heraus. Der Sprung kann beginnen.
Bis hierhin ist das für Genetiker nichts Neues. Neu ist allerdings, dass Forscher herausgefunden haben, wie die Integration am neuen Zielort auf molekularer Ebene abläuft – und wie der Mensch sich das zunutze machen könnte.
Die Teams um Silvana Konermann und Patrick D. Hsu von der University of California in Berkeley und dem Arc Institut in Kalifornien berichten in ihrer Studie, dass das Transposon IS110 seine eigene DNA-Vorlage zunächst ausschneidet und dann eine Brücke aus RNA (bRNA) bildet. Das eine Ende dieser Brücke kann die Stelle in der DNA erkennen, an der das herausgeschnittene Transposon wieder eingefügt werden soll. Das andere Ende erkennt das einzufügende DNA-Stück selbst.
Eine Brücke mit speziellen Enden
Es ist diese Brücke, die Fachleute aufhorchen lässt. Denn Molekularbiologen können im Labor die Brücke anpassen. Auf der einen Seite der Brücke können sie ein beliebiges neues Ziel im Erbgut festlegen. Auf der anderen Seiten können sie eine beliebige Erbinformation definieren, die sie an eben jener Stelle einfügen wollen. „Man hat so ein neues programmierbares Werkzeug geschaffen, jede beliebige DNA an jede beliebige Stelle ins Genom zu integrieren“, kommentiert etwa Holger Puchta, Molekularbiologe am Karlsruher Institut für Technologie.
Was würde das in der Praxis bedeuten? „Zum Beispiel können komplexe genetische Netzwerke in neuronalen Zellen besser untersucht und gezielt modifiziert werden, was Türen für die Erforschung und potenzielle Behandlung von bisher schwer adressierbaren neurologischen Erkrankungen öffnet“, erläutert Manuel Kaulich, Genetiker an der Universität Frankfurt. Denn anders als CRISPR/Cas9 funktioniere IS110 auch in Zellen, die sich nicht mehr teilen, wie etwa die Nervenzellen.
„Besonders im Bereich der Landwirtschaft und Tierzucht besteht ein großer Bedarf an neuen Lösungsansätzen, um genetisch verbesserte Pflanzen und Tiere zu entwickeln, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Umweltveränderungen sind“, fährt Kaulich fort. Auch in der biomedizinischen Forschung zur Entwicklung neuer Therapien für genetische Erkrankungen bestehe ein hoher Bedarf an präzisen Genom-Editierungs-Tools.
Einsatz nur in Bakterien
Gegenüber bisherigen Methoden der Genom-Editierung soll das neue Verfahren zielgenauer sein und weniger ungewollte Nebeneffekte in anderen Bereichen des Erbguts erzeugen. Das gilt bislang jedoch nur für den Einsatz in Bakterien, wo IS110 ursprünglich her stammt. Wie gut das Enzym in pflanzlichen, tierischen oder menschlichen Zellen funktioniert, ist noch unklar. Unter anderem ist jenes Ende der Brücke, das den Zielort im Genom definiert, so kurz, dass die Sequenz statistisch in größeren Genomen nicht mehr eindeutig ist. „Hier müsste man die Länge des Erkennungsbereichs der bRNA erhöhen, damit das System als neues Werkzeug präzise genug ist, um die gesamte Gentechnologie zu revolutionieren“, betont Puchta.
„Die Arbeit stellt einen einfachen Grundsatzbeweis in Bakterien dar, der weit von einer effektiven Anwendung in menschlichen Zellen entfernt ist“, ordnet Chase Beisel, Experte am Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung, ein. Es gebe in diesem Forschungsfeld jedoch bereits einen etablierten Entwicklungsweg, der diese Technologie zum Erfolg führen könnte: Die CRISPR-Technologie wurde in den zwölf Jahren seit ihrer Entdeckung so sehr weiter entwickelt, dass sie heute in vielen Laboren zur Routine gehört und Mediziner bereits erste Gentherapien am Menschen erfolgreich damit durchgeführt haben.