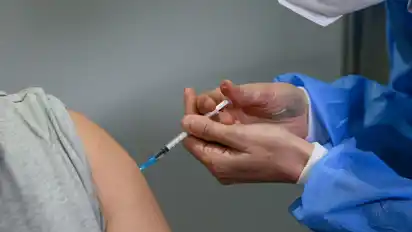In den Supermarktregalen türmen sich glänzende Verpackungen: Gurken in Folie, Kekse in knisternden Beuteln, Joghurt in bunten Bechern. Der Einkaufswagen ist nach wenigen Minuten voll – nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit einem Berg Plastik, der nach dem Auspacken zu Hause bald im Gelben Sack landet. Für die Hersteller ist das praktisch, für Umwelt und Gesundheit ein wachsendes Problem. Denn viele Kunststoffe gelangen in die Natur und in den menschlichen Körper.
Mehr als 400 Millionen Tonnen Kunststoffe werden jährlich weltweit produziert. Ohne Kunststoffe gäbe es keine sterilen Einwegprodukte in der Medizin, keine Satelliten, weder Smartphones noch Autos. Doch nur etwa ein Zehntel aller Kunststoffe wird am Lebensende recycelt, der Rest landet auf Deponien oder in der Natur. Modellierungen, wie viel Plastik jährlich die Umwelt verschmutzen, gehen weit auseinander. Als sicher gilt, dass es mehrere Millionen Tonnen sind – und sie landen überall. Forscher fanden Plastik im arktischen Eis, auf dem Boden der Tiefsee und im Wolkenwasser des Himalaja.
Mikro- und Nanoplastik ließ sich inzwischen in praktisch allen Teilen des menschlichen Körpers nachweisen, auch wenn unklar ist, ob es sich dort anreichert oder wieder ausgeschieden wird – und welchen Schaden es im Körper anrichtet. Ein Viertel der rund 10.000 chemischen Bestandteile von Kunststoffen gilt jedenfalls als gesundheitlich oder ökologisch bedenklich. Nicht zuletzt verantwortet die Kunststoffproduktion 4,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, mehr als der weltweite Schiffs- oder Flugverkehr.
Die Probleme sind weder neu noch unbekannt. Deshalb beschloss die Umweltversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2022, ein Weltplastikabkommen auszuhandeln. Es sollte international und rechtsverbindlich die Plastikverschmutzung bekämpfen, indem es den gesamten Lebenszyklus der Kunststoffe reguliert. Immer wieder stockte der Prozess. Im August fand in Genf die sechste Verhandlungsrunde statt, in der rund 180 Länder einen verabschiedungsreifen Vertragsentwurf diskutierten. Doch nach zehn Tagen wurden die Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen. Ob sie fortgeführt werden, ist nach wie vor offen.
Welche Streitpunkte gibt es?
„Besondere Knackpunkte waren die Begrenzung der Plastikproduktion und die Regelungen zu den Inhaltsstoffen von Kunststoffen“, berichtet Melanie Bergmann. Die Meeresbiologin vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hatte mit der „Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty“ die deutsche Delegation vor Ort begleitet. Die „High Ambition Coalition“ – zu ihr gehören EU-Staaten und zahlreiche Länder des Globalen Südens – drängte auf eine verbindliche Begrenzung der Plastikproduktion, klare Ausstiegsstrategien und Regeln zu Produktdesign und Herstellerverantwortung.
Blockiert haben vor allem ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait und in Teilen die USA, die den Vertrag auf Abfallmanagement und technisches Recycling beschränken wollten: „Da künftig weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden dürfen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, sollen diese vermehrt als Rohstoff für Kunststoffe eingesetzt werden“, erläutert Bergmann. „Diesen Plan B werden diese Länder – verständlicherweise – nicht ohne Weiteres aufgeben, auch wenn dies die Klimakrise weiter befeuern und zulasten der Umwelt und unserer Gesundheit gehen wird.“
„An vielen Stellen ist der Text schwach formuliert, was dem rechtsverbindlichen Mandat der UN-Umweltversammlung von 2022 nicht gerecht wird“, urteilt Bergmann. Der jüngste Entwurf des Vorsitzenden habe zwar einige Verbesserungen gegenüber dem Entwurf vom Tag zuvor enthalten, doch er setze die von vielen Unternehmen geforderten klaren, globalen Verpflichtungen in Bezug auf Ausstiegsstrategien, Produktdesign und erweiterte Herstellerverantwortung nicht um.
Die überwältigende Mehrheit der Staaten zeigte sich zwar bereit, einem ambitionierten Abkommen zuzustimmen, doch weil Entscheidungen üblicherweise einstimmig fallen sollen, reichte das Veto weniger Staaten aus, um den gesamten Prozess zu stoppen. Theoretisch könnte eine Zwei-Drittel-Mehrheit das Abkommen beschließen, doch dann ist die Sorge groß, dass wichtige Staaten nicht mitziehen.
„Wichtig ist jetzt eine Verständigung mit China und Indonesien als Hauptproduzenten von Plastik und Plastikabfällen und als Länder mit langen, verschmutzten Küstenlinien“, sagt Raimund Bleischwitz, der als wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung in Bremen ebenfalls den Verhandlungen beiwohnte. Beide Länder hätten hohe Ambitionen signalisiert und betrieben eine engagierte Politik. „Mit der EU und anderen der ‚High Ambition Coalition’ wäre das eine Mehrheit, die den Vertrag in Kraft treten lassen könnte und wirksam wäre“, ist Bleischwitz überzeugt.
Wurde überhaupt etwas erreicht?
Über 180 Staaten haben über drei Jahre hinweg intensiv verhandelt. Rund 130 Länder haben sich klar zu ehrgeizigen Maßnahmen bekannt. Es zeichnete sich eine Mehrheit ab, die bereit gewesen wäre, stärkere Regeln etwa zu Produktionsreduktion, Produktdesign und Herstellerverantwortung mitzutragen. Auch wurde in Genf erstmals offener über Inhalte gesprochen, nicht nur über Verfahren.
Einige Fachleute sehen im Abbruch der Verhandlungen sogar eine Chance: Ein schwaches, verwässertes Abkommen hätte langfristig wenig Wirkung entfaltet. Stattdessen könnten nun andere Formate gestärkt werden, etwa regionale Allianzen, eine „Koalition der Willigen“ oder ein zweistufiges Modell mit globalen Mindeststandards und zusätzlichen freiwilligen Ambitionen. Staaten, die bislang blockieren, könnten über gezielte Anreize wie Technologietransfer, finanzielle Unterstützung oder politische Partnerschaften eingebunden werden.
„Momentan zeichnet sich offensichtlich noch kein Appetit für eine ‚Koalition der Willigen' ab, die außerhalb des UN-Prozesses ein eigenes ambitioniertes Abkommen auf den Weg bringt“, bewertet Bergmann die Situation. „Wir werden sehen, ob sich das in Zukunft ändern wird, wenn sich auch in einer weiteren Verhandlungsrunde vielleicht nichts bewegt.“