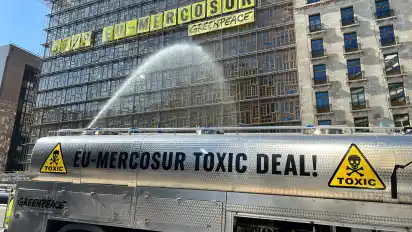Nutzt die EU-Kommission schamlos die Regierungskrise in Frankreich zugunsten der deutschen Wirtschaft aus, wie Kritiker dieser Tage behaupten? Immerhin wagte es die Brüsseler Behördenchefin Ursula von der Leyen am Mittwoch, das finale Abstimmungsverfahren von ausgerechnet jenem Vertrag einzuleiten, gegen den vorneweg Paris mit allem Zorn, den der geschwächte Präsident Emmanuel Macron noch aufbringen kann, seit Jahren rebelliert hatte: das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten.
Nach fast 25 Jahren mühsamer Gespräche und massivem Druck aus Berlin steht die EU kurz davor, den umfangreichsten Handelsdeal ihrer Geschichte mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay abzusegnen. Da kommt es gelegen, dass die Franzosen abgelenkt sind. Aller Voraussicht nach wird Premierminister François Bayrou am Montag gestürzt und weil das Land dann im nächsten Riesendrama steckt, dürften auch protestierende Bauern nicht mehr groß auffallen. So scheint jedenfalls die Hoffnung in Brüssel zu lauten. Denn die Landwirte machen längst mobil gegen das Abkommen. Am Donnerstag demonstrierten bereits Bauern vor dem Brüsseler EU-Parlament. Die Politik stelle wirtschaftlichen Gewinn über Nachhaltigkeit und Fairness, der Deal „lässt die lokalen Landwirte im Stich“, schimpfte eine Protestlerin. Die Farmer befürchten, dass argentinische Rindersteaks und brasilianische Hühnchen den europäischen Markt fluten werden, die nicht denselben Vorschriften unterliegen. In der Bundesrepublik geht es insbesondere um die Produktgruppen Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Ethanol. Das Mercosur-Abkommen sei „unausgewogen“, kritisierte Florian Dalstein vom Brüsseler Büro des deutschen Bauernverbands. Es begünstige die Erzeuger in den Mercosur-Ländern.
Die Ökonomin Samina Sultan, zuständig für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel am Institut der deutschen Wirtschaft, findet dagegen, dass „sehr umfangreich“ auf die Bedenken der Landwirtschaft eingegangen wurde. So setzte die Kommission in Form von Sicherungsmaßnahmen etwa zollfreie Höchstquoten durch. Demnach dürften jährlich maximal 99.000 Tonnen Rindfleisch mit geringerem Zoll in die EU eingeführt werden. Darüber hinaus hat die Union Quoten für Produkte wie Geflügel, Schweinefleisch, Zucker und Reis festgeschrieben. Und einen Geldtopf in Aussicht gestellt, der im Notfall die Bauern finanziell ausgleichen soll.
Es gebe zwar Bereiche auch in der deutschen Landwirtschaft, „die einem verstärkten Druck unterliegen werden“ wie Zucker und Rindfleisch, sagt Handelsexpertin Sultan, aber eben auch jene, „die profitieren könnten“, wie etwa Hersteller von Milchpulver, Käseprodukten oder Wein und Schaumwein. Dalstein schränkt jedoch ein, dass diese „nicht im Verhältnis zu drohenden Wertschöpfungsverlusten in anderen Bereichen stehen“.
Mit der eingängigen Schlagzeile „Cars for Cows“, also „Kühe für Autos“, wird gerne der Kern des Abkommens überschrieben. Das Schlagwort fasst für die Gegner gleichwohl das Problem zusammen. Während auf südamerikanischer Seite insbesondere Agrarerzeuger und Rohstoffkonzerne profitieren dürften, zählen in Europa die Automobilindustrie und ihre Zulieferer sowie Chemie-, Maschinenbau- und Pharmaunternehmen zu den Gewinnern – und damit die Exportnation Deutschland?
„Unterm Strich würde Mercosur zu einem leichten Anstieg der Wirtschaftsleistung führen“, bestätigt Sultan. Doch die Auswirkungen wären „nicht besonders groß“. So prognostizierten sie und eine Reihe weiterer Wissenschaftler in einer vom EU-Parlament in Auftrag gegebenen Studie aus diesem Jahr, dass das Bruttoinlandsprodukt langfristig um 0,1 Prozent wachsen wird. Bei den Exporten rechnen die Experten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent. Das Geschäft mit den USA, in die zehn Prozent der deutschen Exporte gehen, kann Mercosur also nicht ausgleichen. „Aber es ist eine Möglichkeit, unseren Handel zu diversifizieren“, so Sultan. Unter anderem im Maschinenbau dürfte die Herstellung steigen. „Und diese Industriesektoren tragen anteilig viel mehr zur Wertschöpfung in der EU bei als die Landwirtschaft“, so die Ökonomin. Laut Schätzungen der Brüsseler Behörde könne das Abkommen die jährlichen EU-Ausfuhren in die südamerikanischen Staaten um bis zu 39 Prozent und damit um rund 49 Milliarden Euro steigern. 2024 betrug das Handelsvolumen zwischen den beiden Blöcken 112,3 Milliarden Euro.
Die Automobilindustrie setzt Hoffnungen in den Deal. Dessen Bedeutung für die deutsche und europäische Fahrzeugbranche liege unter anderem im Abbau der „aktuell relativ hohen Zölle des Mercosur von derzeit 14 bis 18 Prozent auf Kfz-Teile und sogar 35 Prozent auf Pkw“, hieß es vom Verband der Automobilindustrie. Dabei musste auch diese Zugeständnisse während der Gespräche machen. So hat Brasilien etwa zum Schutz der eigenen Produktion in das Abkommen hineinverhandelt, dass der ursprüngliche Zeitplan für den Zollabbau für Elektrofahrzeuge gestreckt wurde.
Über allem steht jedoch: Mercosur sende „ein sehr wichtiges geo- sowie handelspolitisches Zeichen“, so Sultan. Die EU zeige, „dass sie zu Kooperationen fähig ist und der Freihandel noch stückweit eine Chance hat, obwohl er unter Donald Trump unter Druck gerät“. Der US-Präsident zettelte einen beispiellosen Handelskonflikt an, der viele Europäer zum Umdenken in Sachen Abkommen mit der restlichen Welt bewegte. Nun sollen schon in den nächsten Wochen das Gremium der 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament grünes Licht geben, damit für 91 Prozent aller zwischen der Gemeinschaft und dem Mercosur gehandelten Waren Zölle und Handelsbarrieren schrittweise entfallen können.