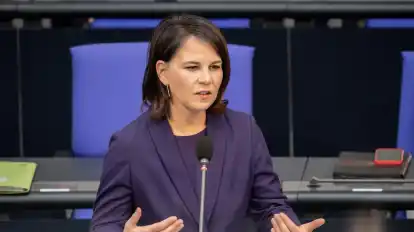Ist es richtig, die Ukraine militärisch zu unterstützen? Werden wir unserer historischen Verantwortung gerecht? Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Auch Fumio Kishida, der Premierminister Japans, ist ihnen ausgesetzt. Deutschland und Japan stehen auf derselben Seite, verurteilen die russische Invasion. Aber wie weit sollte man gehen, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht?
Als Olaf Scholz in Tokio eintraf, stand sein 20-stündiger Besuch in diesem Licht. Zwar hatte er einen Kurzauftritt bei einer Konferenz der deutschen Außenhandelskammer, die ihr 60-jähriges Bestehen in Japan feiert. Die deutsch-japanischen Beziehungen haben sich in der Vergangenheit vordergründig als Wirtschaftsdiplomatie definiert. Doch selbst vor den Unternehmensvertretern ging es um den Krieg in der Ukraine. Eine durch den Konflikt provozierte Deglobalisierung gelte es aufzuhalten, so Scholz: „Sie ist keine Option – erst recht nicht für offene, freie Handelsnationen wie Deutschland und Japan.“ Beide Staaten würden außerdem kooperieren, was Strategien für die Unabhängigkeit von russischem Gas angeht.
Schon dieser Besuch an sich sendet eine klare Botschaft – er ist als überfällige Kurskorrektur der deutschen Außenpolitik zu verstehen. Altkanzlerin Angela Merkel hatte sich bei Asien-Reisen vor allem auf China konzentriert. Wirtschaftliche Interessen schienen stets Priorität zu haben gegenüber oft betonten Idealen wie Demokratie und Menschenrechten.
Die liberale Demokratie Japan schneidet in dieser Hinsicht vollkommen anders ab als das System Russlands oder Chinas. Und in Tokio, wo Scholz am Abend seinen Amtskollegen Kishida zum Dinner traf, gab er zu verstehen, dass Deutschland künftig engeren Kontakt zu solchen Staaten suche, deren Werte mit den eigenen übereinstimmten. In Japan wird der Vortritt, den Scholz mit dieser Reise Tokio gegenüber Peking gibt, als Solidaritäts- und Freundschaftsbekundung begrüßt.
Tatsächlich sind die geopolitischen Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Deutschland in jüngster Zeit immer wieder aufgefallen. So geben sich beide Staaten gerne als Vorreiter im Klimaschutz: Deutschland betont den Ausbau erneuerbarer Energien, Japan positioniert sich als Weltführer in der Entwicklung von Wasserstofftechnologien.
Zurückhaltung beim Ausstieg aus fossilen Energien
Zur Wahrheit gehört aber auch: Beide gehören zu den größten CO2-Emittenten der Welt und wurden bisher schmallippig, wenn es um eine schnellere Kehrtwende ging. Rund um den Krieg in der Ukraine zeigt sich dies erneut, da beide Regierungen davor zurückschrecken, komplett auf Öl- und Gasimporte zu verzichten. Ähnlich schüchtern haben sich Tokio und Berlin in den vergangenen Jahren gegenüber China verhalten. Beiden Staaten waren die ökonomischen Potenziale in China zu groß.
Künftig soll sich dies ändern. Wobei das Betonen der gemeinsamen Werte zwischen Japan und Deutschland neue Konturen erhält. Seit ihren Niederlagen im Zweiten Weltkrieg haben sich beide Staaten bemüht, als globale Friedensboten zu geben. Noch stärker als auf Deutschland trifft dies auf Japan zu: Artikel 9 der Nachkriegsverfassung verbietet dem Staat jede Kriegsführung. Das Militär darf offiziell nicht so heißen, nennt sich Selbstverteidigungskräfte.
So bestehen in Japan – nicht zuletzt bei Parteien links der Mitte – Vorbehalte gegenüber einer nennenswerten militärischen Unterstützung der Ukraine. Während in Deutschland der Bundestag die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine beschlossen hat, liefert Japan bisher nur schusssichere Westen, Winterkleidung und Aufklärungsdrohnen. Für Japan ist schon dies ein großer Schritt.
Japan fürchtet Parallelen beim Fall Taiwan
Zugleich erhofft man sich in Japan deutsche Unterstützung im Pazifik. Die Ansprüche Chinas und die Gefahr einer Invasion ins demokratische Taiwan, die jener Russlands in der Ukraine ähneln könnte, prägt derzeit politische Debatten in Japan. Die Regierung in Tokio hat erklärt, in so einem Fall auf der Seite Taiwans zu stehen. Deutschland ist in dieser Frage bisher vage. Sicherheitspolitische Kooperationen zwischen den beiden Ländern, die auf militärischer Ebene zuletzt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs zusammenarbeiteten, soll weiter intensiviert werden. Zu einer Wertepartnerschaft gehört auch dies.