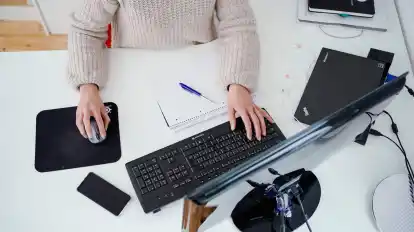Es ist eine neue Art von Epidemie, die sich fast drei Jahre nach dem Auftreten der ersten Covid-19-Fälle in Frankreich ausbreitet: die „Epidemie der Trägheit“. Wie sie sich äußert? Die Menschen wollen weniger ausgehen und arbeiten, sie meiden Kinos und Discos und auf die Frage, wie sie einen idealen Freitagabend verbringen, antwortet mehr als ein Drittel: mit einem leckeren Essen vor dem Fernseher. Nur 15 Prozent bevorzugen ein Treffen mit Freunden.
Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie mit dem Titel „Große Müdigkeit und Epidemie der Trägheit: Wenn sich ein Teil der Franzosen geschlagen gibt“, die der Politologe Jérôme Fourquet vom Meinungsforschungsinstitut Ifop und Jérôme Peltier, Leiter der politischen Stiftung Jean-Jaurès, durchgeführt haben.
30 Prozent der Befragten gaben an, generell weniger motiviert zu sein als vor dem Corona-Jahr 2020. „Der Ruf des Sofas scheint sehr stark zu sein“, heißt es in der Studie. Im nächsten Jahr will das Lexikon „Le Petit Robert“ das Verb chiller, die französische Version für neudeutsch chillen, als neues Wort aufnehmen.
Den Autoren zufolge hat die Pandemie diese Entwicklung nicht ausgelöst, aber beschleunigt. Die Aufeinanderfolge von Krisen in Frankreich in den vergangenen Jahren – von den wiederholten Terror-Attentaten vom Jahr 2015 an über die Widerstandsbewegung der Gelbwesten bis zum Ukraine-Krieg – schaffe ein Klima der Angst. Die Folge sei der Rückzug.
Etliche Indizien hierfür werden angeführt: Die Zahl der Sportvereine ging seit 2020 um 2,2 Prozent zurück, die Besuche bei Psychologen verdoppelten sich, der Verkauf von Video-Projektoren stieg in den beiden vergangenen Jahren jeweils um 50 Prozent. Immer mehr Franzosen verbringen ihre Zeit mit Videospielen und lassen sich Essen nach Hause liefern, anstatt ins Restaurant zu gehen. Zugleich nahm die Zahl der Krankschreibungen insbesondere wegen psychischer Probleme und Burn-out stark zu. Besonders betroffen ist laut Studie die jüngere Generation. 40 Prozent der 25- bis 34-Jährigen sagten demnach, sie fühlten sich mental nicht solide genug, alle Herausforderungen ihres Alltags zu meistern.
Auch das Verhältnis der Französinnen und Franzosen zur Arbeit hat sich offenbar stark verändert: Nahm der Beruf im Jahr 1990 für 60 Prozent einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein, so sagten das jetzt noch 41 Prozent. Eine deutliche Mehrheit würde für mehr Freizeit auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Dabei geht die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden seit Jahren zurück.
Zugleich war die Zahl der Kündigungen seit 14 Jahren nicht mehr so hoch. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch im Bereich der öffentlichen Transportmittel fehlen Tausende Arbeitskräfte. Die französische Regierung reagiert darauf auf zweierlei Weise: Einerseits will sie die Visa-Vergabe für potenzielle Arbeitskräfte in den Branchen unter Druck erleichtern. Andererseits hat sie gerade die Regeln der Arbeitslosenversicherung verschärft und an die jeweilige Konjunkturentwicklung geknüpft.
Er habe Probleme damit, wenn Leute „von der nationalen Solidarität profitieren, um über ihr Leben nachzudenken“, sagte Präsident Emmanuel Macron. „Macron ist ein Hyperaktiver in einem Land, das träger und passiver wird“, kommentierte der Journalist und Autor Franz-Olivier Giesbert. „Dieser Widerspruch wird immer schwieriger zu bewältigen.“
Die Französinnen und Franzosen sind bei diesen Entwicklungen allerdings keine Ausnahme. Auch bei den Deutschen sank die Arbeitsmoral in den vergangenen Jahren: Einer Ende September erschienenen Studie des Meinungsforschungsinstitutes Yougov zufolge würden fast 60 Prozent der deutschen Berufstätigen nicht mehr arbeiten, wenn sie es sich finanziell erlauben könnten. Vor der Pandemie waren es noch knapp 40 Prozent. Fast die Hälfte würde in Teilzeit wechseln, wenn der Arbeitgeber einverstanden wäre – ganz besonders die unter 40-Jährigen.
Demnach sind sich die Menschen des Werts ihrer Zeit stärker bewusst, über die sie frei verfügen wollen – um beispielsweise zu „chillen“.