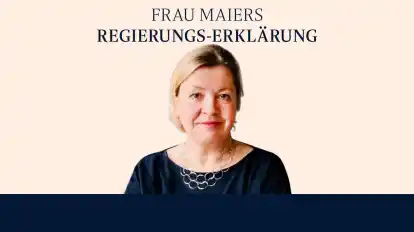Die Ampel steht. Einem fulminanten Auftakt mit der Sondierungsrunde folgten recht beschwerliche Koalitionsverhandlungen. Was aber dabei herausgekommen ist, kann sich durchaus sehen lassen. Beim Klimaschutz haben sich SPD und FDP im Endspurt auf die Grünen zubewegt, im Gegenzug bekommen die Liberalen ihre Rolle als Garant für einen stabilen Staatshaushalt. Und Olaf Scholz kann als künftiger Bundeskanzler unbeirrt auf dem Erfolgspfad seines Wahlkampfs bleiben: Ein Mann, der für gesellschaftlichen Respekt und sozialen Ausgleich steht.
Natürlich gab es am Mittwochnachmittag auch viel Wortgeklingel. Scholz betonte, dass mit Rot-Grün-Gelb "tatsächlich etwas zusammengewachsen ist". Etwas, dass sich manche Beobachter noch vor wenigen Wochen kaum hätten vorzustellen können. Schwamm drüber. Doch ganz so einfach ist es nicht. Wie reißfest dieses Bündnis tatsächlich ist, wird sich kaum in der Abarbeitung von Koalitionsvereinbarungen zeigen. Die großen Herausforderungen stehen weder in einem Koalitionsvertrag noch in einem Kalender. Ob die Anschläge vom 11. September 2001, die Finanz- und Bankenkrise der Jahre 2008 und 2009, das Flüchtlingsdrama von 2015 oder die gegenwärtige Corona-Pandemie: In solchen Momenten zeigt sich erst, wie gut oder schlecht eine Regierung funktioniert – und wie groß das gegenseitige Vertrauen ist.
Scholz mit einer geschickten Strategie
Dass Rote, Grüne und Gelbe am Ende zusammengefunden haben, liegt auch an der geschickten Strategie von Olaf Scholz. Er ließ die beiden Partner nach der Wahl den ersten Zug machen, hielt sich auch danach vornehm zurück. Und: Anders als 1998 Gerhard Schröder und 2009 Angela Merkel speiste Scholz die beiden kleineren Parteien nicht mit ein paar politischen Spielwiesen ab.
Und doch wird es kein einfacher Weg für die Ampel: zu gegensätzlich sind die politischen Fundamente. Man denke nur an die Rolle des Staates, die bei Sozialdemokraten und Grünen viel ausgeprägter ist als bei den Freidemokraten. Wenn Grünen-Chefin Annalena Baerbock etwa über die Innovationskraft von Verboten philosophiert, dürfte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner arge Bauchschmerzen bekommen.
Auch inhaltlich gibt es Reibungspunkte. Klimaschutz, so er denn vernünftig und nachhaltig sein soll, kostet viel Geld. Schon jetzt zeigen die stark steigenden Energiepreise, welch ein politischer Sprengstoff hier verborgen ist. Die Ampelkoalitionäre bewegen sich auf dem schmalen Grat, einerseits die Erderwärmung abzubremsen zu wollen und andererseits die sozialen Gräben in der Gesellschaft nicht noch tiefer werden zu lassen.
Ein großes Problemfeld ist auch der Wohnungsmarkt. Die Ampel will zwar die Mietpreisbremse verschärfen, doch dieses Instrument hat sich in der Praxis als weitgehendend untaugliches Mittel gegen den Preisdruck erwiesen. Die neuen Koalitionäre versprechen zwar eine Forcierung des Wohnungsbaus auf jährlich 400.000 Einheiten, doch bereits diverse Bundes- und Landesregierungen konnten ähnliche Versprechen nicht einhalten. Und dann will die künftige Regierung auch noch eine Herkulesaufgabe anpacken: Milliarden Euro sollen in Klimaschutz und moderne Infrastruktur gesteckt werden. Doch geht das tatsächlich, ohne neue Schulden anzuhäufen?
Und nicht zu vergessen: Man muss nicht nur eine Regierung zusammenhalten, sondern auch die sie tragenden Parteien. Und da stehen einige Umbrüche an. Mit Co-Chef Norbert Walter-Borjans geht bei der SPD ein Mann in den politischen Ruhestand, der sich zwar als linker Sozialdemokrat versteht, aber ausgleichend auf die Basis gewirkt hat. Eine Rolle, für die sein mutmaßlicher Nachfolger Lars Klingbeil beste Voraussetzungen mitbringt, in die er aber erst hineinwachsen muss. Die Grünen verlieren mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beide in Ministerämter wechseln, sogar ihr unbestrittenes Machtzentrum. Und ob die traditionell selbstbewusste FDP-Fraktion auf Dauer treu der Linie von Lindner folgt, ist auch nicht ausgemacht. Gut möglich, dass die eigentliche Gefahr für die neue Regierung nicht von innen, sondern von außen kommt.