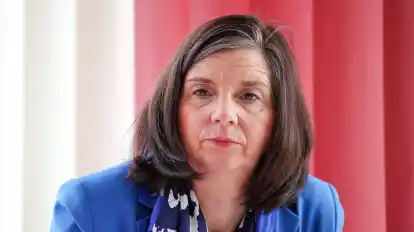Es ist immer wieder bemerkenswert, wie Politiker sich in die Brust werfen und größtmögliche Transparenz versprechen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte in den vergangenen Tagen mehrfach, dass die Coronapolitik der Bundesregierung quasi lückenlos aufgearbeitet werde. Gut so, keine Frage, aber auch eine Selbstverständlichkeit. Die staatlichen Eingriffe in die Freiheiten jedes Einzelnen, in das Wirtschaftsgeschehen, selbst in politische Abläufe waren so weitreichend und folgenschwer, dass die Regierung es der Bevölkerung schuldig ist, die Vorgänge mit Abstand nachzuvollziehen.
Die Umstände, unter denen das derzeit geschieht, sind alles andere als günstig: Nicht etwa das Bundesgesundheitsministerium oder das Kabinett, nicht etwa der Bundestag oder sein Ausschuss für Gesundheit haben sich dahintergeklemmt. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im Sommer 2020 eine politische Aufarbeitung angekündigt, verlor 2021 aber sein Amt. Die FDP, die die Coronapolitik vielfach kritisiert hatte, hat dasselbe gefordert. Aber geschehen ist wenig bis nichts. Erst nachdem kürzlich ein Online-Magazin namens „Multipolar“ die Protokolle des Robert Koch-Instituts veröffentlicht hat, flammte die Debatte wieder auf.
Nach eigenen Angaben hat die Redaktion die Herausgabe mit juristischen Schritten erstritten, die sich auf das Informationsfreiheitsgesetz stützen. Das Portal nimmt für sich in Anspruch „gegenüber der bedrückenden politischen und medialen Formierung der vergangenen Jahre auf Spannungen, Widersprüche, unterschiedliche Perspektiven“ zu setzen. Von Kritikern wird es in die Nähe verschwörungserzählerischer Publikationen gerückt.
Ob diese Kritik berechtigt ist oder nicht, alle Unterlagen gehören ans Licht der Öffentlichkeit, und zwar freiwillig, nicht erzwungenermaßen. Problematisch ist ebenfalls, dass „Multipolar“ bereits einen Teil erstreiten konnte, allerdings wurden manche Passagen vor der Weitergabe unkenntlich gemacht. Es mag Gründe dafür geben – wie plausibel sie sind, wird sich zeigen, wenn Karl Lauterbach sein Versprechen wahr macht und sie „weitestgehend entschwärzen“ lässt. So oder so – vertrauenserweckend ist das nicht. Es ist Wasser auf die Mühlen derer, die fest davon überzeugt sind, die Coronapolitik im Nachgang als bestenfalls unverhältnismäßig oder gar überflüssig enthüllen zu können. Es sind Fehler im Umgang mit Fehlern.
Nicht weniger unklug war es, sich erst spät mit dem Thema Impfschäden zu befassen. Bis vor einem Jahr ließ sich der Bundesgesundheitsminister Zeit, sogenannten Post-Vac-Patienten Hilfe zuzusichern. Es mag sein, dass es – wie bei anderen Impfungen – selten zu Folgen kommt, die als Impfschäden zu bezeichnen sind. Sie aber monatelang auszublenden, war falsch und anmaßend: Offenbar hat Lauterbach den Bürgern nicht zugetraut, mit solchen Informationen umgehen zu können.
- Lesen Sie auch: Schnelle Hilfe bei Impfschäden ist bislang nicht in Sicht
Im Nachhinein ist immer schlau schnacken, aber dass die Coronapolitik nicht fehlerfrei war, steht außer Zweifel. Einige Versäumnisse oder Fehleinschätzung haben einige Politiker bereits eingeräumt, vor allem, was Schulschließungen betrifft, aber auch die berufsbezogene Impfpflicht. Helge Braun, Kanzleramtsminister von Angela Merkel bis 2021, räumte Anfang März gegenüber dem „Spiegel“ ein, dass die Wirkung der Impfungen überschätzt worden sei: „Wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten.“
Selbst wenn man felsenfest davon überzeugt ist, dass sich Bundes- und Landesregierungen vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse um größtmöglichen Schutz mit kleinstmöglichen Konsequenzen für die Bevölkerung bemüht haben: Der kritisch-distanzierte Blick auf die Coronapolitik ist unerlässlich. Es geht nicht darum, mit ausgestrecktem Zeigefinger auf vermeintlich Schuldige zu zeigen. Was sich später als falsch herausgestellt hat, kann damals nach bestem Wissen und Gewissen als richtig oder gar alternativlos erschienen sein. Es gilt, aus Fehlern zu lernen, für ähnliche Krisensituationen, um noch mehr Umsicht walten zu lassen, um noch besser abschätzen zu können, welche sogenannten Kollateralschäden man in Kauf nehmen kann, um größere Katastrophen zu verhindern.