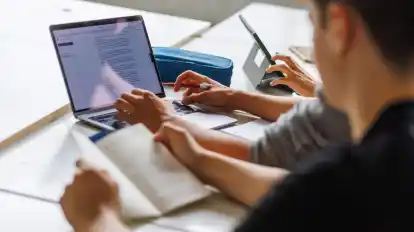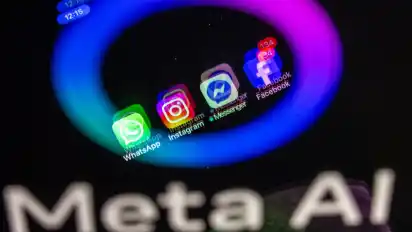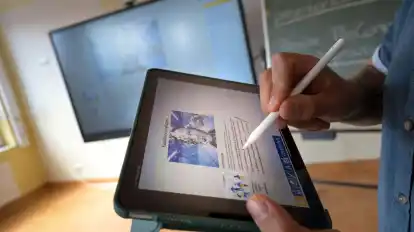Die künstliche Intelligenz verändert nicht nur das Berufsleben, sondern ebenso die Ausbildung von jungen Menschen ganz erheblich. So hat der Digitalverband Bitkom Ende Mai das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter 502 Schülerinnen und Schülern veröffentlicht – mit denkwürdigen Ergebnissen: 23 Prozent der befragten Schüler gaben an, ihre Hausaufgaben kaum noch selbst zu machen, sondern von der KI lösen zu lassen. 44 Prozent der Schüler forderten hingegen, dass die Verwendung von künstlicher Intelligenz bei den Hausaufgaben verboten werden sollte. Ganz ähnliche Auswirkungen haben KI-Anwendungen mittlerweile auch in der Ausbildung und im Studium – und werfen deshalb die Frage auf, ob bestehende Lehr- und Lernformate in Zeiten des technologischen Umbruchs weiter Bestand haben können.
Dabei gibt es eine Reihe an sinnvollen Einsatzszenarien von KI auch in der Schule, beispielsweise beim personalisierten Lernen, indem der individuelle Lernfortschritt analysiert und quasi in Echtzeit Aufgaben angeboten werden, die der Leistung des Schülers entsprechen. Auch beim Erlernen von Sprachen können neue Angebote dabei unterstützen, Vokabeln gezielt zu trainieren oder die Konversationsfähigkeiten zu fördern. Das Land Niedersachsen geht gar so weit und plant einen „Lern-Chatbot“ an den Schulen, der Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen unterstützt – Letztere sogar bei der Erstellung von Unterrichtsmaterial, Hausaufgaben und Klausuren.
Doch so schön die neue KI-Welt in den Schulen auch scheinen mag – die Sorgen und Ängste gegenüber der neuen Technologie sind nicht unberechtigt. So geht aus der eingangs zitierten Umfrage des Bitkom nicht nur hervor, dass sich viele Schülerinnen und Schüler für ein KI-Verbot aussprechen, sondern auch, dass knapp 50 Prozent der befragten Personen gar davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz Schüler „dumm mache“. Hier liegt das Problem vor allem darin, dass viele Menschen sich auf die KI-generierten Ergebnisse blindlings verlassen, ohne kritisch deren Richtigkeit oder Neutralität zu hinterfragen. Auch zu diesem Thema wurden im Mai neue Studienergebnisse einer internationalen Analyse veröffentlicht, wonach nur gut ein Viertel der Chatbot-Nutzer in Deutschland die Ergebnisse gegenprüft.
Gerade bei jungen Menschen in der Ausbildung ist eine solche Tendenz problematisch, denn das Lernen verfolgt gerade den Zweck, nicht nur nach Antworten zu fragen, sondern diese selbst zu finden. Hierauf sind viele Schulen und Ausbildungseinrichtungen aktuell noch nicht vorbereitet, denn es fehlt an KI-Leitlinien, in welchen Bereichen im Unterricht es sinnvoll ist, künstliche Intelligenz zu nutzen – und an welchen Stellen sie die persönliche Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung eher schädigt. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Tatsache, dass ebenfalls knapp 50 Prozent der Schüler geantwortet haben, dass ihnen die Entwicklungen rund um die KI Angst machen würde – ein eindeutiger Beleg dafür, dass derzeit viel Unsicherheit besteht, wenn junge Menschen KI einsetzen.
Gefordert sind hier Politik und Landesschulbehörden, klare Richtlinien im Umgang mit der künstlichen Intelligenz im Lehr- und Lernalltag zu bestimmen, und diese auch durchzusetzen. Teils wird gar gefordert, die Verwendung von KI an Schulen, Ausbildungseinrichtungen und Universitäten grundsätzlich zu verbieten – es sei denn, ihr Einsatz erscheint im konkreten Kontext sinnvoll. Zurzeit sind wir von allgemeinen KI-Leitlinien in der Ausbildung aber noch weit entfernt, obwohl sie schon jetzt fleißig eingesetzt wird, ohne dass wir uns der mittelfristigen Auswirkungen bewusst sind.