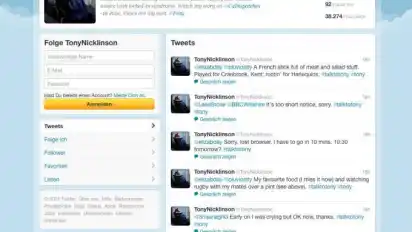Frau Posch, wenn man mit Ihnen mailt, würde man nicht auf die Idee kommen, dass Sie unter besonderen Umständen leben. Wie würden Sie sich Fremden beschreiben?
Katarina Posch: Ich war die große, schlanke, blonde Design-Historikerin, die eine Professur für Designgeschichte und -theorie in New York hatte, und die kein Kind von Traurigkeit war. Jetzt bin ich in Wien, meistens nur noch 130 Zentimeter hoch, denn ich sitze im Rollstuhl, aber ich habe noch immer meinen Drive. Meine Energien und mein Wille sind ungebrochen, auch wenn ich jetzt viel mehr Hilfe als früher brauche. Ich arbeite viel an mir und an allen möglichen Themen. Natürlich auch weiterhin über Design. Aber da mein Geist, mein Gedächtnis und meine Sinne funktionieren, hat sich meine Rolle auch hin zu der einer Advokatin für Menschen mit Einschränkungen verschoben.
Wie beschreiben Sie die Umstände, in denen Sie leben?
Ich lebe in einem der besten Heime in Österreich: Privatzimmer mit Bad und Balkon. Café, Friseur, Ärzte und Sonnenterrasse sind im Haus, und ich habe Familie und Freunde, die sich um mich kümmern. Ich genieße nach wie vor Therapien, den Rest meiner Zeit verbringe ich am Computer, den ich mit den Augen bediene, oder mit dem Fernseher – wenn ich nicht in der Oper, in einer Ausstellung oder im Kaffeehaus bin. Der Hauptunterschied zu meinem früheren Leben ist, dass ich jetzt kaum noch allein sein kann, während ich früher selbstständig durch die ganze Welt gegangen bin. Ich brauche bei Pflege, beim Essen und Trinken, bei kulturellen Veranstaltungen und beim akademischen Arbeiten Hilfe. Aber wenn ich herumliege oder -sitze und denke, fühle ich mich wie immer. Ich bin an das jetzige Leben gewöhnt. Aber ich bin froh, dass ich mein vorheriges Leben sehr ausgeschöpft habe und daher viele Erinnerungen genieße.
Weisen Sie beim ersten Kontakt überhaupt darauf hin, dass Sie sich nicht mal eben mit jemanden zum Kaffee treffen können?
Bis jetzt habe ich alle neuen Menschen durch meine Krankheit kennengelernt, also hat sich diese Frage nie gestellt. Aber wenn ich – nehmen wir an – durch die Medien in Kontakt mit fremden Menschen kommen würde: Würde ich es sagen? Als ich in Japan gearbeitet habe, habe ich einen Fragebogen an japanische Designer geschickt. Damals kam mir es wie eine einmalige Gelegenheit vor, dass niemand mein Geschlecht von meinem Namen ersehen könnte, weil mein Vorname in Japan unbekannt ist. Deshalb glaube ich, ich würde so lange wie möglich nicht sagen, dass ich nicht wie ein „normaler“ Mensch bin. Allerdings ist es ein wichtiger Teil meiner jetzigen Identität, dass ich jetzt mit allen Schwächen akzeptiert werden will. Ich werde sonst nur als die Behinderung wahrgenommen, und genau das ist ja, was ich nicht will. Ein Mensch mit körperlichen Einschränkungen hat noch alle seine geistigen und sensorischen Fähigkeiten.
Sie müssen vermutlich häufig erläutern, worum es sich beim Locked-in-Syndrom handelt.
Locked-in ist wie ein verstopfter Trichter vom Gehirn zum Rest des Körpers: Das Gehirn und alle Sinne funktionieren, aber die Signale kommen nicht bei meinen Muskeln an. Am Anfang konnte ich nur ein Augenlid aufmachen. Heute kann ich den Kopf und den rechten Unterarm rollen, und ich verfüge über mehr Stabilität im Sitzen und Stehen. Ich habe vier Jahre gebraucht, um wieder schlucken zu lernen. Ich kann einige Worte sprechen, und ich kann stehen. Des Weiteren habe ich in jahrelangem Training mit meinen Therapeuten gelernt, selbstständig einen E-Rolli mit meinem Kopf zu steuern. Es ist ein längerer und nicht immer lustiger Weg, sich zu verbessern, aber ich verliere nicht den Mut.
Reden Sie auch darüber, was Ihnen 2015 widerfahren ist?
Kaum. Ich rede auch selten über andere Krankheiten, die ich gehabt habe. Wichtig ist, dass ich das Leben dadurch in Phasen einzuteilen gelernt habe: Alles hat seine Zeit und seinen Ort, aber alles hat auch ein Ablaufdatum; im positiven und im negativen Sinne.
Machen Sie den Medizinern Vorwürfe, die Sie damals behandelt haben?
Ja und nein. Auf der einen Seite weiß ich, dass mir der Chirurg in einer zehnstündigen Operation den Tumor entfernt hatte. Er war schon so groß wie eine Babyfaust und um den Seh- und um den Hörnerv herum gewachsen. Wenn der Chirurg schlampig gearbeitet und die Nerven geschädigt hätte, hätte ich heute auch blind oder taub oder beides sein können. Ich rechne ihm hoch an, dass ich noch über alle meine Sinne verfüge. Aber ich bin sauer auf mich selbst: Ich hatte eine Drei-D-Darstellung der Blutgefäße in meinem Kopf auf CD, und die hatten wir – mein Chirurg und ich – gemeinsam angeschaut, um etwaige Probleme zu sehen. Ich wusste durch mein letztes geplatztes Aneurysma, dass ich anlagemäßig nur eine zuführende Arterie im Hinterkopf habe, wo andere Menschen zwei haben. Ich wollte ihm das nicht sagen, um seine Autorität nicht infrage zu stellen. Der Chef-Neurochirurg des New-York-University-Hospitals würde das doch sehen, habe ich gedacht. Hatte er offenbar aber nicht. Darüber bin ich schon verstimmt, um es nett auszudrücken.
Wie haben Sie vor der OP gelebt?
Ich habe eine reiche Vergangenheit, die ich nicht vergessen will. Ich habe lange darauf hingearbeitet, die Idealvorstellung meines Lebens zu verwirklichen: Nach 18 Jahren Studium und verschiedenen Jobs in kulturellen Einrichtungen in verschiedenen Ländern, wie im Centre Georges Pompidou in Paris, im Vitra Design Museum in Deutschland, in der Arena di Verona in Italien, hatte ich meinen Traumjob in meiner Traumstadt: Ich hatte eine Professur für Designgeschichte und -theorie in New York. Ich habe mir eine Altbauwohnung mit privater Terrasse in Manhattan gekauft und hergerichtet. Ich habe meine Zeit zwischen akademischen Arbeiten, Oper, Ausstellungen, Tangotanzen, Inline-Skating, Kajakfahren und Segeln aufgeteilt und war glücklich in meinen verschiedenen Freundeskreisen. Nach dem Infarkt war ich zerrissen zwischen lustvollen Gedanken an die Vergangenheit und einem Bedürfnis, mich sehr auf die Zukunft zu konzentrieren, weil ich dachte, die intensive Beschäftigung mit den zukünftigen Möglichkeiten würde mein Lernen beschleunigen.
Wie ist Ihnen gelungen, sich mit Ihrem Schicksal zu arrangieren?
Ich glaube, dass ich einige Eigenschaften immer schon gehabt habe: Ich bin ein sehr neugieriger und interessierter Mensch; ich entwerfe gerne mein eigenes Leben und finde Wege dazu. Ich bin es gewohnt, meine Schritte allein zu gehen; wenn eine Gelegenheit sich öffnet, bin ich die Erste, die hineinspringt. Diese Einstellungen haben mir geholfen, mich mit meinem Schicksal zu arrangieren. Man braucht eine wache, positive Grundeinstellung, viel Selbstmotivation, für Neues offen zu sein und den Willen, alles auszuprobieren. Aber natürlich haben mir auch Menschen um mich herum viel Hilfe gegeben: Ohne meine Familie, die sich unglaublich um mich kümmert, ohne die prompte und umsichtige ärztliche und therapeutische Versorgung, und ohne die gute Pflege hier im Haus der Barmherzigkeit wäre ich sicher nicht so positiv. Und glücklicherweise habe ich gute Freunde auf drei Kontinenten, die mir die Treue halten.
Ihre Schwestern und Ihre Eltern spielen in Ihrem Leben eine große Rolle. Hat sich Ihre Beziehung verändert?
Ich wusste immer, dass ich mich auf meine Familie würde verlassen können, obwohl wir auch unsere Schwierigkeiten hatten. Aber ich wusste, dass in Zeiten der Not all die Probleme hintangestellt würden. Und so war es da dann auch: Meine Familie hat mich bestmöglich untergebracht, nachdem sie mir durch eine enorme Spenden-Aktion ermöglicht hatten, nach der missglückten Operation mit einem medizinischen Jet nach Wien zurückzukommen. Mein Vater hat sich sofort um meine finanziellen Belange gekümmert, meine Mutter um meine kulturellen, meine ältere Schwester Elisabeth um alle ärztlichen und alle praktischen. Meine Schwester Sophie um meine persönlichen Probleme. Nicht nur sie hat schnell wieder zu unserem alten Schwestern-Ton zurückgefunden; auch mein Cousin Harald, der durch seinen Beruf als Behindertenbetreuer und durch seine große Empathie sofort hinter mein Handicap schauen konnte, hat mit mir ein inniges Verhältnis. Aber von den meisten anderen Leuten habe ich das Gefühl vermittelt bekommen, nur ja dankbar für jeden Handgriff für mich sein zu müssen und sonst besser nicht auf mich aufmerksam zu machen. Selbstverständlich bin ich dankbar, aber ich bin doch viel mehr.
Gibt es noch dunkle Stunden, in denen Sie mit Ihrem Schicksal hadern?
Natürlich gibt es dunkle Stunden. Interessanterweise nie, wenn ich alleine bin. Irgendwo herumzusitzen oder -liegen und zu denken war mein liebster Zustand. Wenn möglich, in der Sonne mit einem Drink in der Hand. Auch bei den meisten Menschen stört es mich nicht besonders, nicht sprechen zu können: Man erspart sich viele Gespräche, die eigentlich nur heiße Luft sind. Aber wenn ich mit Freunden vom Fach bin, möchte ich mich am Gespräch beteiligen. Ich habe etwas zu sagen und möchte das gleich tun, sonst ist der Witz weg. Das sind die Momente, in denen ich wünschte, das Ganze wäre nur ein böser Traum.
Ihr Leben hat sich dramatisch verändert, hat sich irgendetwas zum Positiven gewendet?
Es gibt tatsächlich auch positive Seiten des Locked-in-Syndroms: Man kann arbeiten, wozu man Lust hat, wenn Arbeiten Denken heißt. Dank eines guten sozialen Systems, das wir in Österreich haben und in das ich freiwillig eingezahlt habe, ist der existenzielle Druck ziemlich verschwunden. Nichts mehr selber machen zu können, ist schwer; nichts mehr selber machen zu müssen, ist Luxus. Ich brauche mir nicht einmal mehr selbst die Haare zu bürsten. Ich brauche nicht selbst Auto zu fahren, und wenn ich mich dem öffentlichen Verkehr überlasse, dann stets auf reserviertem Platz. In Theatern und in der Oper werden mir Plätze zugewiesen, in Preisklassen, die ich mir als Normalbürger nie leisten würde. Ich fühle mich privilegiert, dass ich, seit ich locked-in bin, tolle Leute kennenlernen durfte.
Sind Sie – von den körperlichen Einschränkungen abgesehen – noch der Mensch, der Sie einmal waren?
Ich war vorher in der privilegierten Situation, mein Leben nach meinem Geschmack einrichten zu können. Ich war Mitte 30 und ohne Anhang und konnte das Leben im Big Apple sehr ausnützen, so, wie es mir gefällt. Es war schwer, auf das Leben, das ich zuvor hatte, zu verzichten. Ich habe die ersten Jahre nur geweint. Aber die Arbeit hat mir gezeigt, dass ich noch etwas von meinem Leben haben kann. Ich habe verstanden, dass ich mehr bin als die Behinderung. Alles braucht mehrere Menschen und dauert länger, aber es ist möglich. Ich habe gelernt, die positiven Seiten zu genießen. Ich habe viel gelernt seit dem Infarkt. Also betrachte ich mich jetzt als Katarina 2.0.
Ist es Ihnen schwergefallen, Hilfe annehmen zu müssen?
Anfangs ist mir das sehr schwergefallen. Ich habe mich mein ganzes Leben bemüht, alles selbst machen zu können. Ich konnte genauso eine Wohnung eigenhändig renovieren wie ein Fünf-Gänge-Menü auf den Tisch zaubern. Ich wollte nie von jemandem abhängig sein, schon gar nicht von einem Ehemann. Ich bin so recht gut durchs Leben gekommen. Ich habe gelebt, wo ich wollte, ich habe mich immer mit interessanten Sachen beschäftigt, und ich habe viele interessante Menschen kennengelernt. Vieles davon geht allein nicht mehr. Was über das Internet geht – wie dieses Interview – mache ich allein, aber für vieles bräuchte ich zumindest Begleitung. Ich habe zwar ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, aber manchmal finde ich niemanden und muss auf eine Aktivität verzichten. Theater und Oper ist noch heute schwer, weil es schwierig ist, jemanden mit demselben Interesse und Niveau zu finden, und ich möchte niemanden zur Last fallen. Aber ich habe akzeptiert, nicht für das Glück anderer Leute verantwortlich zu sein. Wenn jemand etwas für mich macht, bin ich dankbar, denke mir aber auch, dass er oder sie etwas davon haben wird – und wenn es nur die Bezahlung ist. Es ist mir bewusst, dass meine frühere Tätigkeit nicht unbedingt Dankbarkeit ausgelöst hat. Aber ich denke: Ich habe mir diesen Zustand nicht ausgesucht, ich habe der Gesellschaft viel gegeben, also darf ich jetzt Hilfe empfangen.
In einem Beitrag auf der Homepage des Hauses der Barmherzigkeit, in dem Sie leben, sagen Sie: „Meine positive Einstellung zum Leben ist ungebrochen!“ Woher kommt diese Kraft?
Ich wüsste auch gerne, woher ich diese Kraft hernehme. Im Ernst – ich kann dem Spruch viel abgewinnen: Lebe jeden Tag so gelassen, als hättest du noch 100 Jahre zu leben und so fokussiert, als wäre das dein letzter.
Was würden Sie gerne unternehmen, was nicht so leicht zu verwirklichen ist?
Einen schwierig zu realisierenden Wunsch hätte ich: Ich würde gerne ans Meer reisen. Irgendwo vor einem schönen Setting wie vor einem venezianischen Palazzo oder vor einem tropischen Palmenstrand mit einem guten Cocktail, das wäre schon fantastisch. Aber Venedig wäre schwierig, weil ich dafür eine Sänfte mit starken Trägern bräuchte und ein Hotelzimmer mit einem Pflegebett. Und um in die Tropen zu kommen, müsste ich in ein Flugzeug kommen. Businessclass, ein beherzter starker Pfleger und ein Reiserollstuhl würden das vielleicht ermöglichen, aber die müssten erst aufgetrieben werden.
Sie sind weiterhin wissenschaftlich tätig. Woran arbeiten Sie?
Ich habe letzten Frühsommer einen Vortrag zum Thema „ Humor und Design“ mit meiner geklonten Stimme gehalten. Damit habe ich beide meiner Anliegen vertreten: das Design und die Verbesserung der Möglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen. Es war ein schöner Erfolg, der von Radio und Fernsehen dokumentiert wurde. Derzeit arbeite ich auch mit einem meiner ehemaligen Studenten an einem Buch über die Entwicklung des modernen Designs in der westlichen Welt. Das ist das vierte Buchprojekt, das ich seit dem Infarkt begonnen habe. Die anderen drei liegen auf Eis. Ich habe nicht genug Zeit für alles gleichzeitig. Ich schreibe ja auf einem Spezial-Computer, den ich mit dem Blick steuern kann. Das nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als ein Zehn-Finger-System. Auch wenn ich jetzt zwei absolut tüchtige Recherche-Assistentinnen habe, haben meine Tage immer noch nur 24 Stunden.
Ihre Schwester Sophie sagt in dem Text, den ich eben erwähnt habe: „Das wird wieder.“ Sind Sie auch davon überzeugt?
Ich bin offen für alles, was kommt: Ich bereite mich psychisch und physisch durch Therapien so gut wie möglich darauf vor, wieder gesund zu werden, aber wenn es nichts wird, kann ich auch diesem Leben etwas abgewinnen. Es gibt kein ideales Leben – jedes hat Einschränkungen. Das heißt, es kommt darauf an, was man aus den Gegebenheiten macht.