Wilhelm Zimmann lernte seine zukünftige Frau Ende der 1940er-Jahre kennen. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, es war eine Zeit des Aufbruchs und Wiederaufbaus. Die beiden heirateten 1954, bauten ein Haus in Findorff und lebten dort mehr als 40 Jahre zusammen. Jeden Tag ihres gemeinsamen Lebens. Als sie 1997 starb, war er 82 Jahre alt. Ein paar Jahre war sie auf seine Hilfe angewiesen gewesen. Er hatte sie versorgt und sich selbst zurückgestellt. Jetzt war alles um ihn herum ohrenbetäubend still.
Wie lebt man weiter, wenn der langjährige Partner stirbt? Lange Zeit war die gängige Annahme, dass Trauer in verschiedenen Phasen verläuft. Vereinfacht gesagt geht es darum, Trauer zuzulassen, zu verarbeiten, sie zu bewältigen und zu überwinden. Das klingt nach einer Liste, die ein trauernder Mensch abhaken kann. Und es würde bedeuten, dass es einen Anfang und ein Ende der Trauer gibt.

Die Lücke, die ein Verstorbener hinterlässt, kann sich nicht schließen. Das muss sie auch nicht. Den Toten einen neuen Platz im Leben zu geben, kann Trauer lindern.
Jeder Mensch trauert auf seine Weise, braucht unterschiedliche Unterstützung und Zeit, um aus der Einsamkeit herauszufinden. Trauer lässt sich nicht in Phasen einsortieren, ist Chris Paul überzeugt. Die Trauerbegleiterin, Autorin und Dozentin aus Bonn hat ein anderes Modell entwickelt. „Trauern ist ein dynamischer Prozess mit wiederkehrenden Themen“, sagt sie. Nach einem Verlust gehe jeder Mensch seinen individuellen Trauerweg in seinem ganz eigenen Tempo, aber alle Trauernden bewegen sich auf denselben Themenfeldern.
Chris Paul nennt sie „Facetten des Trauerns“. Wie bei einem Kaleidoskop überlappen sich die verschiedenen Gefühle wie Farben, mal ist die eine stärker als die andere, immer wieder bilden sich neue Muster.
Dass sich die Vorstellung etabliert hat, man müsse mit dem Verlust abschließen und sich auf das Leben ausrichten, hängt mit den Kriegserfahrungen in Europa des Ersten Weltkriegs zusammen, glaubt Robert Neimeyer. Er ist Professor für Klinische Psychotherapie an der Universität von Memphis in den USA. Hunderttausende Menschen sind diesem Krieg zum Opfer gefallen. Die Reaktion auf das Unbeschreibliche sei eher ein „posttraumatischer Zustand des Vermeidens“ wird Neimeyer in einem Artikel bei ARD Alpha zitiert.
Die Lücke, die ein Verstorbener hinterlässt, kann sich nicht schließen. Das muss sie auch nicht. Dafür verwendet Niemeyer den Begriff „continuing bonds“, was bedeutet, die Beziehungen mit der verstorbenen Person fortzuführen. Das ermöglicht, sich weiterhin an den Menschen erinnern zu können, über ihn zu sprechen, dem Toten einen Platz im Leben zu bewahren. Herbert Grönemeyer hat es in einem Lied über seine verstorbene Frau so formuliert: „Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.“

Sibylle de Bondt ist Trauerbegleiterin. Sie steht an der Seite von Menschen, wenn diese einen nahestehenden Menschen verloren haben. Ihnen hilft sie, mit Trauer und Einsamkeit umzugehen.
Die Bremer Trauerbegleiterin Sibylle de Bondt hilft Menschen in der Trauer um einen nahestehenden Menschen. In ihrer Trauerpraxis in der Benningsenstraße 1b nimmt sie sich Zeit zum Zuhören. Denn es geht viel um das Verstehen und Begreifen. Der Tod kann plötzlich, im hohen Alter oder nach einer langen Krankheit kommen. Es macht einen Unterschied, ob es eine Zeit der Vorbereitung gab, eine Auseinandersetzung mit dem Tod, Vollmachten und Verfügungen, so de Bondts Erfahrung. Gab es Gespräche im Vorfeld über eigene Wünsche? „Wie will ich beerdigt werden? Wie soll meine Trauerfeier ablaufen? Das ist immens wichtig für diejenigen, die zurückbleiben“, sagt de Bondt.
Menschen sind soziale Wesen. Sie brauchen Bezugspersonen. Im Zusammensein mit anderen haben Spiegelneuronen im Gehirn eine wichtige Funktion. Die Nervenzellen werden aktiviert, wenn Menschen handeln, eine Handlung beobachten oder auch nur über sie nachdenken. Sie sind dafür zuständig, dass der Mensch die Gefühle und Stimmungen von anderen Menschen erkennt. Wenn einer gähnt, gähnen die anderen mit.
„In einer langjährigen Partnerschaft baut sich ein ganzes Netzwerk im Gehirn auf“, erläutert de Bondt. „Nach dem Tod werden die vertrauten Bahnen gekappt. Es fehlt der innere Spiegel. Das ist eine Stresssituation. Ich erkenne mich selbst nicht mehr, denn es findet keine Rückmeldung mehr statt.“ Der Mensch trauert also mit Körper und Seele. „Die gewohnten Vereinbarungen, Spiegelungen und Absicherungen gehen verloren, alles kommt ins Wanken.“ Gleiches passiert, wenn Haustiere oder langjährige Freunde sterben.
Als sie erfuhr, dass ihre langjährige Freundin gestorben war, fühlte es sich wie ein Taumel an. Als würde der Boden unter ihr sich drehen. Corinna Friedrich, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, bekam keine Luft mehr. Sie und ihre Freundin hatten sich als elfjährige Mädchen kennengelernt. Bis zum Ende der Schulzeit waren sie fast unzertrennlich. Auch in den darauffolgenden Jahren hatten sie immer wieder Kontakt zueinander. Mehr als 40 Jahre lang. „Jetzt ist sie einfach nicht mehr da, und ich konnte mich nicht von ihr verabschieden“, sagt die heute 54-jährige Bremerin. „Es ist, als würde eine feste Säule meines Lebens wegbrechen. Ich fühle mich schuldig, dass ich am Ende nicht für sie da gewesen bin.“
Trost in der ersten Phase haben Corinna Friedrich Gespräche mit gemeinsamen Freunden gegeben. „Es hilft, sich zusammen an viele Momente zu erinnern, gute und auch schlechte. Alte Fotos anzuschauen. Es rückt den verlorenen Menschen sehr nah heran und bringt vieles wieder ins Gedächtnis.“ Sie will jetzt einen Brief an ihre Freundin schreiben, darüber, warum sie dankbar für die gemeinsame Zeit ist.
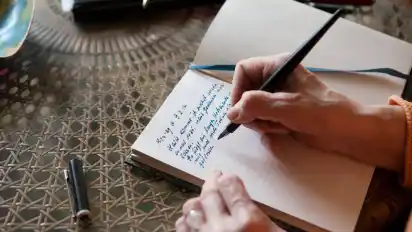
Schöne Momente zu notieren, kann Trauernden helfen. Auch ein Trauertagebuch kann den Schmerz lindern – es macht einem zum Beispiel die eigenen Gefühle bewusst.
Wilhelm Zimmann hatte ein gutes soziales Netz, als seine Frau starb. An seiner Seite waren seine Tochter, die Enkelkinder, Freunde und eine Cousine, die sich sehr um ihn kümmerte. Vor allem in der sogenannten Schleusenzeit, der Zeitspanne zwischen Tod und Bestattung, halfen sie ihm, Abschied zu nehmen. Schritt für Schritt fand er neue Rituale im Alltag und schaffte es, den Weg weiterzugehen. Er ging wieder auf Reisen. Er traf sich mit der Enkelin zu Kaffee und Kuchen am Nachmittag und verbrachte Zeit mit seiner Urenkelin. Jeden Donnerstag kam seine Tochter, kaufte ein, kochte und aß mit ihm zu Mittag. Am Abend führte er zu Hause leise Zwiegespräche mit seiner verstorbenen Frau. Denn der Austausch über das Erlebte mit ihr fehlte ihm bis zum Schluss am meisten.
Wie das Gedenken leichter fallen kann
Abschied nehmen, bedeutet nicht loszulassen. Die Bremer Trauerbegleiterin Sibylle de Bondt findet es wichtig, mit den verstorbenen Menschen in Verbindung zu bleiben. Mit diesen Impulsen kann das Gedenken leichter fallen.
- Zum Grab oder Bestattungsort gehen und ganz bewusst den Blick für die kleinen Dinge dort öffnen. Eichhörnchen oder Vögel beobachten. Auf Zeichen achten, die mit dem Herzensmenschen verbinden. Was finde ich auf dem Weg dorthin?
- Verbundenheit in der Trauer finden und den Blick weiten für Personen, die sich am Bestattungsort aufhalten. Vielleicht miteinander ins Gespräch kommen.
- Sich von einem Menschen begleiten lassen beim Gang zur Bestattungsstätte.
- Ein Trauertagebuch schreiben.
- Einen Brief an den Herzensmenschen schreiben. „Du kannst stolz auf mich sein, weil …“ oder „Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit, weil …“
- Den Brief mitnehmen zum Grab oder an einen Lieblingsort.
- Den Brief ins Tagebuch legen oder ihn dem Meer, dem Fluss übergeben oder sicher verbrennen.
- Mit der Familie zusammen das Lieblingsgericht des oder der Verstorbenen kochen.
- Zum Erinnerungskaffee mit Freunden und Familie treffen. Jeder bringt einen Gegenstand oder ein Bild mit, das an die Verstorbene oder den Verstorbenen erinnert, und erzählt warum.

In der Verbundenheit mit der Natur, können Hinterbliebene Kraft schöpfen. Jeder Mensch trägt solche Kraftorte in sich, glaubt Sibylle de Bondt.




