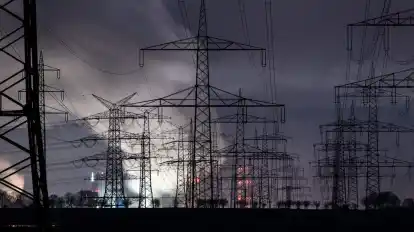Bremerhaven war vor zehn Jahren die „Offshore-Windhauptstadt“ Deutschlands, mit vier großen Werken und an die 4000 Arbeitsplätzen. Davon ist praktisch nichts geblieben. Jetzt erlebt die Offshore-Windenergie eine große Renaissance. Ärgert es Sie, dass die für die Bremerhavener Hersteller zu spät kommt?
Nils Schnorrenberger: Ja klar. Vor 20 Jahren, als wir mit der Entwicklung der Offshore-Windenergie in Bremerhaven begonnen haben, war eigentlich klar, dass wir diese Technologie für die nächsten Jahrzehnte brauchen würden, wenn wir den Klimawandel bremsen wollen. Der Krieg in der Ukraine hat unsere Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern jetzt noch deutlicher gemacht. Dass die Hersteller in Bremerhaven ihre Werke trotzdem schließen mussten, ist enorm ärgerlich.
Wenn wir noch einmal kurz zurückschauen: Was waren die Ursachen für das Scheitern der Offshore-Pioniere in Bremerhaven?
Die Bundesregierung hatte sehr früh Ausbauziele für die Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee vorgegeben, nämlich 25 Gigawatt installierte Leistung. Das war die Grundlage für die Investitionsentscheidungen der Industrie. Die Werke wurden gebaut, Personal wurde eingestellt, bevor es die ersten Aufträge gab.
Das ging damals ja alles sehr schnell.
Heute muss man sagen: zu schnell. Die Hersteller mussten viel Lehrgeld für eine Technologie zahlen, die noch nicht ausreichend erprobt war – die Gewährleistung für Kinderkrankheiten der Anlagen wurde sehr teuer. Und gleichzeitig verschlechterte sich die Marktperspektive durch die Verringerung der Ausbauziele.
Weil der Offshore-Windstrom zu teuer war.
Investoren und Versicherungen mussten von der neuen Technologie erst überzeugt werden, mit hohen Einspeisevergütungen für den Offshore-Strom von bis zu 19,5 Cent pro Kilowattstunde. Dadurch stieg der Strompreis. Die damalige Bundesregierung kappte deshalb 2014 die Ausbauziele für Offshore-Windenergie auf 15 Gigawatt. Das war sehr kurzsichtig und ein großer Fehler.
Die jetzige Bundesregierung setzt der Offshore-Windenergie viel höhere Ausbauziele, strebt eine Verzehnfachung der Leistung bis 2045 an. Haben Sie schon Anrufe von Windrad-Herstellern bekommen, die nach einem Grundstück für ihr neues Werk suchen?
Nein, noch nicht. Das Gesetz ist ja gerade erst verabschiedet worden. Es gibt noch keine neuen Genehmigungen für Windparks, für die die Hersteller nach Kapazitäten suchen.
Rechnen Sie denn noch mit Anrufen? Oder muss man einfach anerkennen: Die verbliebenen Hersteller haben ihre Werke – die kann man erweitern, um mehr Anlagen zu bauen?
Nein, das glaube ich nicht. Die vorhandenen Kapazitäten werden nicht reichen.

"Butendiek" vor Sylt: Offshore-Windparks sollen eine wichtige Säule in der Energiegewinnung der kommenden Jahrzehnte werden.
Auch nicht bei Siemens in Cuxhaven?
Da gibt es sicherlich Erweiterungsmöglichkeiten, aber wir brauchen ja viel mehr: Wir brauchen Kabel, wir brauchen Fundamente, Türme, Gondeln, Rotorblätter. Der Bedarf an zusätzlichen Flächen für Produktion und Logistik wird wachsen, das ist ganz klar.
Was hat Bremerhaven da zu bieten?
Im Moment passen die großen Errichterschiffe für die Offshore-Windparks durch die Kaiserschleuse und an die seeschifftiefen Kajen am Wasser ...
Also an den Containerterminal.
Wir haben ja den CT 1 ganz im Süden des Containerterminals und die ABC-Halbinsel in den Kaiserhäfen schon einmal für die Offshore-Windindustrie genutzt. Wenn wir uns mittelfristig die Potenziale der erneuerbaren Energien anschauen, bin ich sicher, dass sich hier die Chance für zusätzliche Wertschöpfung als Ergänzung zum Auto- und Containerumschlag bieten wird. Und davon könnten auch die gegenwärtig dort tätigen Unternehmen profitieren.
Und im Fischereihafen, wo die großen Werke der Bremerhavener Offshore-Industrie standen?
Die Errichterschiffe passen nicht durch die Fischereihafenschleuse. Darum haben wir ja damals den Offshore-Terminal OTB geplant, direkt an der Weser. Die Gerichte haben den Bedarf seinerzeit nicht anerkannt. Man wird sehen, ob wir jetzt mit einer erweiterten Argumentation noch einmal eine Chance bekommen. Wir sind da im Verfahren.
Mit dem OTB ist Bremerhaven damals zu spät gekommen; die Unternehmen waren schon weg. Jetzt gibt es Pläne für ein Nachfolgeprojekt in abgewandelter Form. Warum soll es damit besser laufen?
Der BUND hatte gegen den OTB geklagt, weil der Bedarf nicht mehr gegeben sei. Aber mit den neuen Ausbauzielen und der Forcierung des Problems durch den Ukraine-Krieg liegt der Bedarf jetzt ja auf der Hand.
Eine entsprechende Studie ist gerade in Arbeit. Wann liegt die vor?
Wir lassen das wirtschaftliche Potenzial für Bremerhaven durch die Energiewende untersuchen, Ende des Jahres rechnen wir mit den Ergebnissen.
Ist das nicht schon wieder zu spät? Andere Häfen bringen sich längst in Position.
Wir stehen immer noch ganz am Anfang des Umbaus einer auf fossilen Energiequellen beruhenden Industriegesellschaft. Wir elektrifizieren eine Industrie und eine Gesellschaft, die bislang auf Kohle, Öl und Gas basierte. Die Technologien sind vielfach – wenn überhaupt – erst im Prototypenstadium. Deshalb bin ich froh, dass wir Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, mit dieser Studie noch einmal untersuchen können.
Sie haben Bremerhaven auch als Recycling- und Entsorgungsstation für ausgediente Windräder ins Spiel gebracht. Gibt es da Interesse aus der Industrie?
Entsorgung ist der falsche Begriff – wir wollen ja alles im Kreislauf halten. Bei einigen Komponenten ist das noch etwas problematisch, aber gerade vor dem Hintergrund der immer schwierigeren Beschaffung von Rohstoffen ist es das Ziel, möglichst alles wiederzuverwerten. Da gibt es Interesse sowohl von den Betreibern der Windparks, die ja verpflichtet sind, ihre Anlagen irgendwann zurückzubauen, als auch aus der Kreislaufwirtschaft.
Bremerhaven setzt auch auf die Wasserstoff-Industrie. Das macht aber gefühlt gerade jeder. Was hat Bremerhaven zu bieten, was sonst keiner hat?
Wir konzentrieren uns auf bestimmte Nutzungen für Wasserstoff, zum Beispiel für Fahrzeuge im Hafen oder für die Schifffahrt. Wir planen einen Simulator, mit dem bestimmte Komponenten vor der Nutzung auf See getestet werden können. Und wir haben mit dem Fraunhofer IWES ein Institut am Ort, das sich bislang mit der Windenergie beschäftigt hat und seine Forschungen jetzt auf Wasserstoff als Speichertechnologie ausdehnt. Die wissenschaftliche Kompetenz wird gerade enorm ausgebaut. Da sind wir vielen anderen Standorten weit voraus.