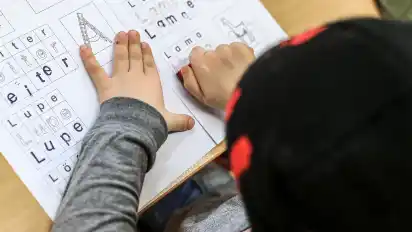Wer im Ausland zum Lehrer ausgebildet wurde, hat in Deutschland schlechte Karten. Erst vor wenigen Wochen hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz den Finger auf die Wunde gelegt: 80 Prozent der ausländischen Lehrkräfte bemühen sich in Deutschland vergeblich um Anerkennung – trotz des Lehrermangels.
In Bremen sieht die Lage kaum besser aus, aktuell durchlaufen 13 Personen mit ausländischer Lehramtsqualifikation eine Anpassungsmaßnahme. Damit werde das Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Auf 100 oder mehr Lehrkräfte für Bremen und Bremerhaven schätzt Landesvorstandssprecherin Elke Suhr die stille Reserve.
Es sei mehr Transparenz in den Verfahren nötig, zugleich müssten die Hürden für eine Anerkennung gesenkt werden. Momentan nimmt das Anerkennungsverfahren laut Suhr deutlich zu viel Zeit in Anspruch. In einem ihr bekannten Fall habe sich das Verfahren über acht Jahre hingezogen und sei erst im zweiten Anlauf erfolgreich gewesen.
Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) räumt ein, dass noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgereizt sind. „Bei uns leben sehr viele Menschen, die einen pädagogischen Abschluss im Ausland erworben haben“, sagt die Senatorin. „Diese Menschen brauchen wir in Bremens Schulen.“
Wie schleppend die Anerkennung bundesweit verläuft, macht eine GEW-Studie deutlich. Danach erhalten 17 Prozent der Antragsteller einen Ablehnungsbescheid und 68 Prozent die Auflage, an einer Ausgleichsmaßnahme teilzunehmen. Elf Prozent der Anträge werden als gleichwertig anerkannt. Dieses Manko zeigt sich auch in Bremen. Von den Lehrkräften, die 2015 mit der Flüchtlingswelle aus Syrien gekommen sind, haben es Suhr zufolge nur sehr wenige in ihren angestammten Beruf geschafft.
Einen wesentlichen Stolperstein sieht die GEW darin, dass Lehrkräfte in fast allen Staaten der Welt in einem Fach ausgebildet werden, in Deutschland aber zwei Fächer unterrichten müssen. „Lange Zeit haben die maßgeblichen Stellen auf vergleichbare Universitätsabschlüsse bestanden“, sagt die zweite Landesvorstandssprecherin Barbara Schüll. Erst jetzt scheine es als Reaktion auf den sich „katastrophal zuspitzenden Fachkräftemangel“ einen pragmatischen, lösungsorientierten Blick auf Abschlüsse, Anpassungswege und Anerkennung zu geben.
Tatsächlich hat Bremen die Schulen für Quereinsteiger mit nur einem Fach geöffnet, im März sollen die ersten 50 Ein-Fach-Lehrer ihren Dienst aufnehmen. Bei ausländischen Bewerbern überprüft das staatliche Prüfungsamt routinemäßig, ob eine Gleichstellung zu einem Lehramt mit zwei Fächern bewilligt werden kann oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Zugleich stellt das Prüfungsamt auch fest, ob es möglich ist, die Lehrbefähigung in nur einem Fach zu erteilen. Für die GEW gibt es noch Luft nach oben. „Da hat sich Bremen bewegt“, sagt Suhr, „es geht uns aber noch nicht weit genug.
Der springende Punkt ist der Unterschied zwischen der Lehrbefähigung für ein Fach und der Lehramtsbefähigung für zwei Fächer. „Keine Lehramtsbefähigung zu haben macht sich im Portemonnaie bemerkbar“, sagt Suhr. Die Lösung aus ihrer Sicht: Ein-Fach-Lehrer müssten mit gleicher Bezahlung wie Zwei-Fach-Lehrer rechnen können. „Zumal sie wahrscheinlich ohnehin fachfremd unterrichten müssen.“ Auf zwei Unterrichtsfächern zu beharren, empfindet Suhr angesichts der derzeitigen Notlage als nicht mehr zeitgemäß.
Die Senatorin signalisiert Gesprächsbereitschaft. Bei einer Veranstaltung mit der GEW an diesem Montag will sie sich mit ausländischen Lehrkräften austauschen. Dabei hat sie nicht so sehr Lehrkräfte aus dem EU-Ausland oder Großbritannien im Blick. Heißt es doch auf der Website der Bildungsbehörde: „Lehrkräfte mit Migrationshintergrund werden besonders gesucht.“ Ausländische Lehrkräfte würden gerade dort gebraucht, wo Kinder mit unterschiedlichsten Sprachen aufwachsen und zur Schule gehen. „Deshalb müssen wir kreative Wege gehen, um sie in unsere Schulen zu holen“, so Aulepp.
Einige solcher Wege haben die Bildungsexperten der SWK kürzlich formuliert. Die geringe Erfolgsquote in den Anerkennungslehrgängen müsse analysiert und verbessert werden. Neben dem Verzicht auf ein zweites Unterrichtsfach regen die Experten an, die Anerkennungsrichtlinien „generell auf weitere Hürden zu überprüfen“. Ein weiterer Punkt: Mentoren sollen die migrierten Lehrkräfte in der schulischen Anfangsphase begleiten.