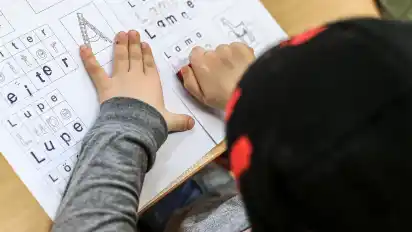Frau Heritani, zuletzt hat man bei Vera-3-Tests gesehen, dass sehr viele Drittklässler die Grundlagen im Lesen und Rechnen nicht beherrschen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Sprache, damit Kinder in der Schule gut lernen können?
Jasmina Heritani: Ich glaube, Sprache ist dafür sehr wichtig. Wir haben in Bremen einen hohen Anteil von Kindern mit anderer Herkunftssprache in den Schulen. Heute kommen viele Bremer Kinder mit geringen Deutschkenntnissen in die Schule, vor allem, wenn sie nicht vorher im Kindergarten waren. Es gibt heute größere Gruppen in den Klassen, deren Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen, um dem Fachunterricht zu folgen. Die Sprachbarrieren sind einfach da. Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, den Kindern zu ermöglichen, den Themen zu folgen.
Was kann da helfen?
Wir stellen immer wieder fest, dass Kinder, die zu Hause mit einer anderen Sprache aufwachsen, in der Schule eine Aufgabe lösen können, wenn wir sie übersetzen. Ich habe Mathematik zuerst auf Arabisch gelernt, weil meine Eltern mich für das erste Grundschuljahr auf eine Schule in Syrien geschickt haben. Und später hatte ich dann Probleme, Mathe-Aufgaben auf Deutsch zu lösen. Und dabei wurde ich in der syrischen Grundschule in Mathematik gut ausgebildet und war vom Stoff sogar weiter als die deutsche Klasse, in die ich kam. Und ich bin ja sogar mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen, aber mir fehlten damals einfach die deutschen Fachbegriffe in Mathe.
Und später als Erwachsene haben Sie ähnliche Situationen aus anderer Perspektive erlebt?
Jahre später habe ich ein Projekt geleitet, dass syrische Lehrkräfte an Bremer Schulen geholt hat. Ich erinnere mich bis heute an diesen Unterricht. Da war zum Beispiel ein Junge, der an der Tafel etwas vorrechnen sollte. Es war keine schwierige Aufgabe, aber er hat es nicht verstanden. Dann hat der Lehrer dem Jungen die Aufgabe kurz auf Arabisch erklärt. Der Junge lief direkt wieder zur Tafel und hat die Berechnung korrekt gemacht. Der Lehrer sagte mir: ,Wenn ich den Kindern das neue Thema in ihrer Herkunftssprache erkläre, und ihnen die wichtigsten Fachbegriffe auf Deutsch vermittele, dann klappt das doch.' Man braucht also Sprache, um Mathe-Aufgaben lösen zu können.
Wir haben an Bremer Schulen zum Teil Klassen mit 70 oder 80 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund und vielen verschiedenen Sprachen. Was können Lehrer tun, die nicht so viele Sprachen sprechen?
Wenn ich als Lehrkraft ein neues Thema im Unterricht einführe, muss ich das nicht nur inhaltlich einführen, sondern auch sprachlich. Auch an deutschen Schulen im Ausland finden Kinder schnell den Anschluss an die Sprache. Eltern sind immer wieder fasziniert, wie gut das funktioniert. Wenn ich in einem Deutschkurs an der Volkshochschule ein Thema beginne, führe ich erst einmal Vokabeln ein und erkläre sie auf Deutsch. Man ist dann natürlich langsamer. Trotzdem brauchen wir die sprachliche Einführung neuer Themen auch im Bremer Schulalltag.
Wie kam es, dass Sie in Deutschland und Syrien zur Schule gegangen sind?
Ich bin in Deutschland geboren und bin Kind eines syrischen Bildungsmigranten, der vor 50 Jahren zum Studium nach Deutschland gekommen ist. Im Studium hat mein Vater dann meine Mutter kennengelernt und ist in Deutschland geblieben. Meine Mutter ist Deutsche, und unsere Familiensprache war immer Deutsch. Als ich fünf war und meine Großmutter aus Syrien uns besuchte, hat mein Vater mit Schrecken festgestellt, dass ich kein Arabisch sprechen konnte. Da sind meine Eltern auf die Idee gekommen, mich ein Jahr auf eine syrische Schule zu schicken, damit ich die Sprache lerne. An meinem ersten Schultag in Aleppo konnte ich nur ein einziges Wort Arabisch: Merhaba und mehr nicht.
Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie das war?
Ich kann mich bis heute an den ersten Schultag erinnern. Alle haben versucht, mit mir zu sprechen, und ich habe natürlich nichts verstanden. Alle anderen konnten Arabisch. Geholfen hat mir, dass ich zusammen mit meiner Cousine in der Klasse war. Es hat drei Monate gedauert, dann konnte ich gut Arabisch sprechen. Und ich wurde von der Schule mit offenen Armen aufgenommen. Als ich dann an eine deutsche Grundschule kam, war meine Erfahrung nicht so toll. Damals hatte man an der Schule eher die Haltung: Wenn dieses Mädchen in Syrien zur Schule gegangen ist, ist es nicht möglich, dass sie hier an der deutschen Schule den Anschluss schafft. Später habe ich dann einen Deutsch-Leistungskurs belegt und unter anderem Germanistik studiert.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, was sagen Sie: Was muss sich an Bremer Schulen verändern, damit Kinder mit anderer Muttersprache gut lernen können?
Im Grunde brauchen wir drei Säulen: Wir brauchen Fortbildungen in Deutsch als Zweitsprache für alle Bremer Lehrkräfte. Wir brauchen ein Programm, um ausländische Lehrkräfte ohne Master-Abschluss als Zweitkräfte an die Schulen zu holen. Und wir brauchen an den Schulen eine mehrsprachige Elternarbeit, um die Eltern gut mit einzubinden.
Auch als Mitglied der Gruppe "Weitwinkel Bildung" haben Sie mehr Sprachförderung gefordert. Sie sagen, es braucht Fortbildungen in Deutsch als Fremdsprache für Lehrer - was meinen Sie damit konkret?
Wir haben eine Gruppe von Lehrkräften an den Bremer Schulen, die ein Modul Deutsch als Zweitsprache (DAZ) im Studium belegt haben. Das ist aber nur ein kleinerer Teil, denn den Bereich DAZ gibt es noch gar nicht so lange. Alle Lehrkräfte für alle Fächer müssen qualifiziert werden mit einem Modul Deutsch als Zweitsprache, auch Lehrer für Mathematik, Physik, Geschichte. Es geht um verpflichtende, auf die Praxis ausgerichtete Fortbildungen. Damit alle wissen, welche Sprachförderung sie in ihren Unterricht einbauen müssen. Und gleichzeitig weiß ich, dass Lehrkräfte, die zum Beispiel in Gröpelingen und Huchting arbeiten, jeden Tag einen Wahnsinnseinsatz zeigen, um junge Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Ich weiß, wie hoch der Druck auf die Lehrkräfte ist, vor allem, weil in vielen Schulen Personal fehlt.
Sie sagen, man müsste mehrsprachige Zweitkräfte an die Schulen holen. Wie könnte das aussehen?
Den Quereinstieg für die Ein-Fach-Lehrkräfte hat Bremen jetzt geregelt, darüber freue ich mich sehr. Jetzt müssen wir noch ein Qualifizierungsprogramm entwickeln, damit wir diejenigen, die nicht die Voraussetzungen für dieses erste Programm erfüllen, auch an die Schulen holen. In vielen Ländern kann man auch mit einem Bachelor-Abschluss an einer Schule unterrichten. Ohne Master geht das bei uns nicht. Aber man könnte diese Gruppe als Zweitkräfte an die Schulen holen und sie berufsbegleitend weiterqualifizieren. Dann hätten wir mit diesen mehrsprachigen Zweitkräften eine Unterstützung für die Lehrkräfte vor Ort. Und die Zweitkräfte könnten auch zugewanderte Eltern in deren Herkunftssprachen beraten. Wir brauchen die Vielfalt, die wir in den Klassen haben, auch im Lehrerzimmer.
Das Gespräch führte Sara Sundermann.