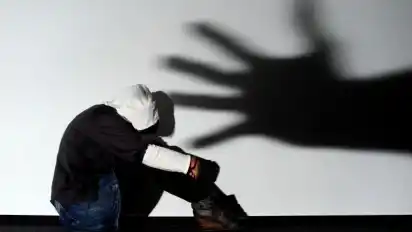145 Verfahren gab es 2012 wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung. Nur 16 davon landeten allerdings vor Gericht. Eine noch nicht veröffentlichte Studie zeigt: Die Polizei könnte Fehler gemacht haben.
Warum führen in Bremen so wenig angezeigte Vergewaltigungen zu einer Anklage? Und wenn sie dann doch vor Gericht landen, warum werden so wenige Verdächtige verurteilt? Nach einer noch nicht veröffentlichten Studie, die dem WESER-KURIER vorliegt, könnte es auch an Ermittlungsdefiziten bei der Polizei liegen. Und an Qualitätsmängeln bei der Staatsanwaltschaft.
Im Auftrag von Innen- und Justizbehörde hat das Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (IPOS) der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen die 145 Verfahren untersucht, die es 2012 wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung gab. Vor Gericht endeten nur 16 der 145 Verfahren, in sieben davon verurteilte ein Richter die Beschuldigten.
Bremen: Verurteilungsquote von 3,9 Prozent
Die geringe Zahl von Anklagen und Verurteilungen ist allerdings kein Bremer Phänomen. Laut IPOS lag die Verurteilungsquote 2012 deutschlandweit bei 8,4 Prozent. In Bremen waren es 5,5 Prozent. Und dies umfasste nur die Fälle, bei denen es einen Beschuldigten gab. Rechnet man hierzu noch die 54 Fälle von 2012 hinzu, in denen kein Verdächtiger ermittelt werden konnte, lag die Verurteilungsquote bei 3,9 Prozent. Anders ausgedrückt: Das Risiko eines Täters, nach einer angezeigten Sexualstraftat verurteilt zu werden, liegt in Bremen unter vier Prozent.
Das Institut stützt seine Analyse auf zwei Faktoren – die Auswertung der Akten der Staatsanwaltschaft für 2012 sowie anschließenden Expertengespräche genannte Runden mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Das Ergebnis der Analyse fällt differenziert aus: So bescheinigt das Institut der Polizei, bei der Spurensuche und -sicherung gut und schnell vorzugehen. Defizite seien hier nicht zu erkennen. Auch die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft und deren Entscheidungen zur Einstellung so vieler Verfahren werden in Gänze weder kritisiert noch für falsch gehalten.
Forscher: "Polizei protokolliert mangelhaft"
Trotzdem blieben Zweifel an den Entscheidungen, die zu den Einstellungen führen, konstatiert die Forschungsgruppe und benennt weiter Schwachpunkte. Allen voran die mangelhafte Protokollierung der Aussagen von Opfern bei der Polizei: So würden diese Zeugenaussagen beim Kriminaldauerdienst erst nachträglich in Form von Gedächtnisprotokollen festgehalten. Und beim Sonderdezernat K32 soll die vernehmende Beamtin das traumatisierte Opfer zwar sensibel befragen, zugleich aber während der Befragung das Protokoll führen. Audio- oder Videoaufnahmen der Befragung gebe es nicht. Und dies, obwohl den ersten Aussagen der Opfer im gesamten weiteren Verfahren und vor allem vor Gericht zentrale Bedeutung zukomme. Diese Art der Protokollierung könne nur als „mangelhaft“ bewertet werden.
Wenn das K32 die Vernehmungen per Video aufnehmen würde, gebe es allerdings hinterher keine Schreibkräfte, die die Aussagen abtippen, ergänzt das IPOS. Nicht die einzige Stelle, an der der Bericht auf fehlendes Personal hinweist.
Als problematisches Ermittlungsdefizit bezeichnet das Institut, dass es kaum Ermittlungen gegen die Verdächtigen gibt. Ein Qualitätsmangel sei zudem, dass vor Gericht in vielen Fällen nicht die Staatsanwältin auftritt, die den Fall bis zur Anklage bearbeitet hat. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft wird in dem Bericht als eher formal bezeichnet, auch hier wird den Behörden Verbesserungsbedarf bescheinigt. Gleiches gelte für einschlägige Fortbildungen der Justiz. Die Forscher stellen zum Beispiel infrage, ob neueste Erkenntnisse der Aussagepsychologie ausreichend gewürdigt würden.
Institut rät zu mehr Personal
Über das Gutachten wurde bereits seit Monaten mit den Beteiligten diskutiert und es gibt eine Reihe gemeinsamer Verbesserungsvorschläge. Die Senkung der Einstellungsquoten oder eine Erhöhung der Zahl von Verurteilungen dürfe allerdings nicht als Selbstzweck angestrebt werden, betont das IPOS abschließend. Sie könne immer nur mögliche Folge einer besseren Aufklärung des Tatgeschehens sein. Diese sei das Ziel aller Empfehlungen des Untersuchungsberichtes.
Und auch dies gibt das Institut den Auftraggebern der Studie mit auf den Weg: Sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden, werde der Arbeitsaufwand auf allen Ebenen steigen. Um qualitätssteigernde Maßnahmen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten abarbeiten zu können, müsse also personelle Vorsorge betrieben werden.