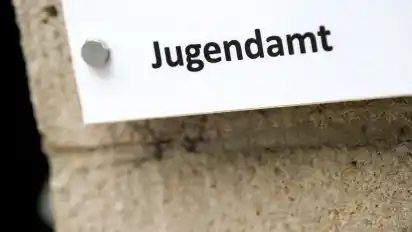Timon Grönert zuckt fast unmerklich mit den Schultern. "Mit diesem Spagat werden wir immer leben müssen", sagt der frisch gekürte Leiter des Bremer Jugendamtes. Gemeint ist die Doppelrolle seines Amtes: Auf der einen Seite diejenigen zu sein, die für Kinder, Jugendliche und Familien Hilfen organisieren, auf der anderen Seite eine Art Überwachungsinstanz, die verpflichtet ist, bei Gefährdungen des Kindeswohls einzugreifen bis hin zur Ultima Ratio: Kinder von ihren Eltern zu trennen. "Wobei das letzte Wort darüber die Familiengerichte haben, nicht das Jugendamt", betont Grönert.
Genau 853 Fälle solcher sogenannter Inobhutnahmen listet die jüngste, vorläufige Statistik für 2019 in Bremen auf. Bei 358 Betroffenen (42 Prozent) handelte es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die mehr oder weniger automatisch in die Zuständigkeit des Jugendamtes fallen. Eine Inobhutnahme direkt aus dem Elternhaus, ohne dass die Kinder zuvor beispielsweise ausgerissen waren und anderweitig aufgegriffen wurden, kam 271 mal vor. Als Hauptgrund nennt die Statistik dabei 250 mal "Überforderung der Eltern oder eines Elternteils." Die Zahlen liegen insgesamt etwas über den Jahren davor, aber nicht auffällig darüber. Wie sich das Corona-Jahr 2020 ausgewirkt hat, ist noch nicht ausgewertet. Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts, spricht von einem "erhöhten Plateau" auf dem sich die Zahlen eingependelt hätten, seitdem sie in den ersten Jahren "nach dem Fall Kevin" stark gestiegen sind.
Auch nach 15 Jahren noch präsent: Der Fall Kevin
Der "Fall Kevin": Das ist für das Jugendamt auch jetzt noch die große Zäsur. Es gibt eine Zeit davor und eine Zeit danach. Markiert wird der Umbruch durch den 10. Oktober 2006, als in Gröpelingen die Leiche des zweijährigen Kevin im Tiefkühlschrank seines Ziehvaters gefunden wird. Der Leiche ist mit Blutergüssen übersät. Die Gerichtsmedizin zählt 21 Knochenbrüche. Als das Kind tot aufgefunden wurde, stand es schon unter der Vormundschaft des Jugendamtes, aber ein mit 240 Fällen überforderter Fallmanager hatte zahlreiche Hinweise auf die Gefährdung des Jungen nicht ernst genug genommen.
Im Nachgang hat sich das Jugendamt vollständig gehäutet. Die heutige Behörde hat laut Grönert nicht mehr viel mit dem Amt von 2006 gemein. Der 35-Jährige hatte mit dem Umbau direkt nicht viel zu tun, aber bevor er Amtsleiter wurde, hat er selbst als Fallmanager gearbeitet. "In dieser Rolle ist man heute nicht mehr allein, jede Entscheidung wird in Teams besprochen."
Prinzipiell will Grönert aber die Zahlen der Inobhutnahmen gar nicht so breit treten. Wenn sie steigen, seien sie je kein Beleg für besonderen Fleiß der Mitarbeitenden. "Unser Interesse ist eigentlich die präventive Arbeit, die sich darum bemüht, frühzeitig zu helfen, damit es gar nicht erst soweit kommen muss." Das nehme heute über 80 Prozent der Aktivitäten der rund 500 Beamten und Angestellten in Anspruch. Als Erfolgsnachweis des Jugendamtes sieht er eher den Umstand, dass die Zahl der eingriffsstarken Maßnahmen und Hilfen sogar zurückgegangen ist. "Wir können heute viel früher mit Familien in Kontakt treten, nicht erst, wenn die Probleme massiv sind."
Grönert wirbt dafür um Vertrauen. "Wir sind dann am wirksamsten, wenn Kinder und Eltern von sich aus auf uns zukommen und nach Unterstützung fragen", sagt er. Man müsse sich von dem Gedanken lösen, bei der Erziehung versagt zu haben, wenn man Hilfe suche. "Wir schauen auch nicht allein auf individuelle Schwierigkeiten, sondern betrachten immer den ganzen Sozialraum der Menschen." Das heißt, auch Nachbarn, Freunde, Großeltern und Lehrer spielen bei den Bemühungen des Jugendamtes um das jeweilige Kindeswohl eine Rolle.
Dabei will Grönert auch von den Strukturen seines Amtes profitieren. "Wir sind als Jugendamt vollständig im Amt für soziale Dienste (AfSD) integriert", sagt der Leiter. Das Amt sei weder Unterabteilung noch ein abgeschotteter Bereich. "Im Grunde steht da Jugendamt drauf, weil es laut Gesetz eines geben muss." Unter dem Titel seien einfach alle Bereiche versammelt, die sich um die Gruppe der Null- bis 21-Jährigen drehen. Dazu zählen auch reine verwaltungstechnische Aufgaben wie die Antragsbearbeitungen bei Elterngeld und Unterhaltsvorschüssen. In seiner Position als Jugendamtsleiter ist er automatisch stellvertretender Leiter des AfSD. "Es hilft, eine gemeinsame Behörde zu sein. Wir haben im Alltag ständig Berührungspunkte mit anderen Zuständigkeiten", sagt Grönert.
Als neuer Leiter sieht er sich nicht als großer Erneuerer. "Es geht eher darum, die begonnenen Veränderungen kontinuierlich fortzusetzen, uns immer wieder zu überprüfen und weiter Vertrauen aufzubauen." Besondere Herausforderungen sieht er weniger in den Arbeitsprozessen, als bei der Suche nach Mitarbeitern. Es seien eigentlich immer Stellen offen und der Fachkräftemangel eine Realität.