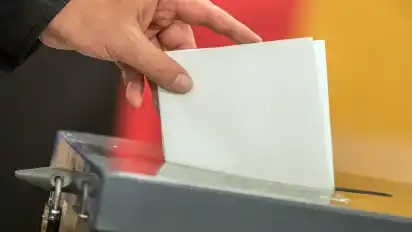Bei der anstehenden Bundestagswahl könnten weniger Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme abgeben als im Jahr 2017. Diese Vermutung legt eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung nahe. Als Grund führen die Autoren einerseits an, dass viele der ehemaligen Protestwähler zur Nichtwahl zurückkehren würden. Zudem sei bei einigen Gruppen eine gewisse coronabedingte Wahlmüdigkeit erkennbar. Als Indiz dafür sehen die Studienmacher rückläufige Beteiligungen bei den diesjährigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.
In Bremen lag die Beteiligung an der Bundestagswahl 2017 bei etwa 71 Prozent – der zweitniedrigste Wert unter allen Bundesländern. Das Landeswahlamt hält sich mit Prognosen für die in zwei Wochen anstehende Wahl zurück. Zwar sei bereits bekannt, dass der Anteil der Briefwähler deutlich steigen werde – eine Entwicklung der Wahlbeteiligung lasse sich daraus jedoch nicht ableiten, sagt Evelyn Temme von der Landeswahlleitung.
Der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst geht nicht davon aus, dass in diesem Jahr weniger Bremerinnen und Bremer wählen werden. "Ich erwarte eine Wahlbeteiligung um die 70 Prozent", sagt er. Zwar könnten die Landtagswahlen als Anhaltspunkte genommen werden, allerdings habe die Pandemie seitdem an Schärfe verloren. Außerdem habe ein offener Wahlausgang erfahrungsgemäß eine mobilisierende Wirkung. "Wir haben das bei der Landtagswahl 2019 in Bremen gesehen. Das Wettrennen zwischen CDU und SPD hat viele Leute an die Urnen getrieben", sagt Probst.
Bremen sei in gewisser Weise ein Sonderfall. "Es gibt hier eine soziale Spreizung, die stärker als in anderen Bundesländern ausfällt", erklärt der Politikwissenschaftler. Die Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen seien immens. So habe die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 in Schwachhausen fast doppelt so hoch gelegen wie in Osterholz-Tenever. Der Osterholzer Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter ist optimistisch, dass in diesem Jahr mehr Menschen aus dem Stadtteil ihre Stimmen abgeben werden. Das Ortsamt ist erstmals als Briefwahlzentrum ausgewählt worden. "Für viele Leute ist das eine Erleichterung, weil sie schon vorab direkt vor Ort ihre Stimme abgeben können", sagt Schlüter. Zudem hätten die Parteien von positiver Resonanz an den Ständen berichtet, und auch Wahlkampfveranstaltungen habe es zahlreich gegeben.
Auch Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Er glaube, dass sich die coronabedingte Wahlmüdigkeit und das offene Rennen um die neue Regierung in etwa ausgleichen werden. Imhoff appelliert an die Bürger, ihr Grundrecht wahrzunehmen. "In anderen Ländern werden Kämpfe dafür geführt, wählen zu dürfen", sagt er. Vielleicht sei es hierzulande eine Art "Es läuft ja alles", die zur Nichtwahl führe, vermutet Imhoff.
Mittlerweile seien die Wähler viel wechselhafter in ihren Entscheidungen als früher, sagt Probst. "Damit ist nicht nur das Springen zwischen den einzelnen Parteien gemeint, sondern auch die Entscheidung, überhaupt wählen zu gehen." Die Politikwissenschaft unterscheide zwischen konjunkturellen und dauerhaften Nichtwählern. Erstere würden sich anschauen, welche Parteien welche Themen bedienen und mit welchen Kandidaten antreten. "Wenn ihnen etwas zusagt, gehen sie wählen – wenn nicht, dann nicht", erklärt Probst.
Dauerhafte Nichtwähler seien oftmals Systemverweigerer. "Die erreicht man auch nicht durch Kampagnen", sagt Probst. Ohnehin sei deren Wirkung zweifelhaft. Unabhängige Kampagnen, beispielsweise von Prominenten, hätten bei vergangenen Wahlen die Beteiligung kaum beeinflusst. Probst schätzt, dass in diesem Jahr die SPD den größten Anteil von ehemaligen Nichtwählern für sich gewinnen kann. "Scholz spricht wahrscheinlich viele SPD-Wähler an, die sich zuletzt von der Partei abgewendet und nicht gewählt hatten." Außerdem sehen die Umfragen ihn vorne, was Probst zufolge einen selbstverstärkenden Effekt haben könnte.
Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sieht Imhoff die Politik in der Verantwortung. "Man muss raus, mit den Leuten sprechen und zuhören", sagt er. Nur so ließe sich zum Beispiel vermitteln, warum manche politischen Prozesse länger als von den Bürgern gewünscht brauchen. Gerade angesichts der geringen Wahlbeteiligung bei jungen Menschen sei es zudem eine Daueraufgabe, Politik in den Schulen zu vermitteln. Schlüter plädiert langfristig für ganz neue Konzepte: Das Wahllokal solle zu den Leuten kommen. Zum Beispiel in Einkaufszentren wie den Weserpark. Und das, wenn es nach Schlüter geht, nicht nur am Wahltag, sondern über einen längeren Zeitraum.