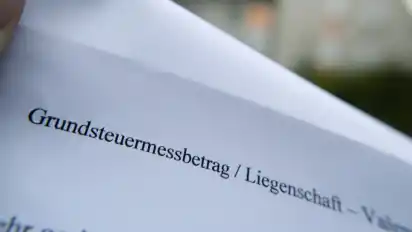Frau Linnert, bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungskonformität der jetzigen Grundsteuer-Berechnung dauert es noch, welches sind die größten Befürchtungen aufseiten der Länderfinanzminister beziehungsweise Bremens?
Karoline Linnert: Der schlimmste Fall wäre natürlich der Totalausfall der Grundsteuer. Das wäre katastrophal für die meisten Kommunen. So weit wird es wohl nicht kommen. Sollte das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer für verfassungswidrig erklären, kann es gleichzeitig eine Frist setzen, bis wann der Gesetzgeber ein verfassungskonformes Grundsteuergesetz vorlegen muss. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Warum ist die Grundsteuer eine so wichtige Einnahmequelle? Mit einem Zehntel der kommunalen Steuereinnahmen ist das doch nicht die Welt.
Für Bremen waren das im Jahr 2017 knapp 166 Millionen Euro. Eine enorme Summe, die wir für die Finanzierung unserer Aufgaben dringend brauchen. Die Grundsteuereinnahmen sind außerdem konjunkturunabhängig und krisenfest – was längst nicht für alle Steuereinnahmen gilt. Denken Sie nur an die letzte Weltwirtschaftskrise, als die Steuereinnahmen drastisch in den Keller gingen.
Bislang wurde argumentiert, eine Überprüfung der Bemessungsgrundlage alle sechs Jahre lohne sich nicht – der Aufwand stehe in keinem Verhältnis zu den Einnahmen.
Der Gesetzgeber hatte 1964 eigentlich eine Neubewertung aller Immobilien nach sechs Jahren vorgesehen; das macht viel Arbeit. Hilfreich könnten Verfahren sein, bei denen aus den jeweiligen Stadtteilen Richtwerte zugrunde gelegt werden, beispielsweise durch Werte des Bremer Gutachterausschusses. Sollte ein Immobilienbesitzer nicht einverstanden sein mit seinem Bescheid, könnte er Einspruch einlegen und dann würde der konkrete Einzelfall überprüft.
Zöge nicht genau das enormen Aufwand nach sich?
Es stimmt, eine Neubewertung macht viel Arbeit. Aktuelle Kostenschätzungen haben die Länder dazu bisher nicht angestellt. Eins ist klar – passieren muss etwas. Die fortschreitende Digitalisierung hilft aber, den Aufwand zu verringern.
Daraus könnte man folgern, dass der zusätzliche Aufwand aus der Grundsteuer finanziert werden soll. Ist das so? Und wenn ja, kann man das noch „aufkommensneutral“ bezeichnen?
Eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer, für die ich mich immer eingesetzt habe, bedeutet, dass nach der Reform nicht mehr Geld in der Kasse sein wird als vorher. Einige Immobilienbesitzer werden profitieren, andere müssen mehr zahlen. Wir können doch nicht einen verfassungswidrigen Zustand tolerieren, weil uns Neubewertungen zu unbequem sind.
Wie konnte es Ihrer Meinung überhaupt dazu kommen, dass eine Reform über Jahrzehnte versäumt wurde?
Da spielen viele Gründe eine Rolle. Den angeblich zu hohen Verwaltungsaufwand halte ich für vorgeschoben. Einige wollen die Grundsteuer ganz zu Fall bringen. Man sieht an dieser Debatte sehr gut, wie schwer es ist, die Interessen von Menschen in benachteiligten Stadtteilen gegenüber den Interessen von einflussreichen, vermögenden Gruppen durchzusetzen. Außerdem hat der Bund immer auf eine einheitliche Positionierung der Länder gepocht. 14 der 16 Bundesländer haben sich letztlich geeinigt – das war keine leichte Geburt.
Warum sind Bayern und Hamburg dagegen?
Die Bayern verfolgen konsequent die Linie, reiche Steuerzahler möglichst wenig zu belasten, bei der Debatte um die Vermögens-, die Erbschafts- und auch bei der Grundsteuer. Ich habe gehört, dass in Bayern spekuliert wird, das Land werde beim Verlust der Grundsteuer die Einnahmeeinbußen der Kommunen ausgleichen. Die Grundsteuer soll allein Ländersache werden. Ziel ist eine niedrige Grundsteuer als Konkurrenzvorteil – ein positiver Standortfaktor.
Und Hamburg?
Hamburg dagegen befürchtet, durch das Kompromissmodell werde es zu Belastungsverschiebungen und einem deutlichen Anstieg der Grundsteuer kommen. Außerdem befürchten die Hamburger höhere Einzahlungen in den Länderfinanzausgleich. Die Höhe der Grundsteuer hängt jedoch auch von den Hebesätzen der Gemeinden ab. Auch bei steigendem Grundstückswert kann durch Absenken der Hebesätze die Höhe der Grundsteuer konstant bleiben.
Wenn Bayern seine Bürger von Grundsteuern befreien oder die Hebesätze auf null senken würde, was bedeutete das für den Rest der Republik?
Ausweichreaktionen von Einwohnern im Grenzbereich zu Bayern sind nicht auszuschließen. Ein Wegzug aus einer Kommune, in der keine Grundsteuer erhoben wird, könnte attraktiv sein. Das gilt aber auch schon heute in Fällen von unterschiedlich hohen Hebesätzen in den Gemeinden.
Was spricht dagegen, dass die Grundsteuer komplett zur Ländersache wird?
Das würde zu einem steuerrechtlichen Flickenteppich führen – im Zweifel mit 16 verschiedenen Regeln. Reiche Länder könnten sich weitere Konkurrenzvorteile über einen niedrigen Steuersatz verschaffen.
Was sagen Sie Villenbesitzern in Oberneuland, die ansonsten nicht unbedingt begütert sein müssen?
Jeder Mensch sollte ein Interesse an einer verfassungskonformen und gerechten Grundsteuer haben. Das ist der Fall, wenn sich die Steuer an dem aktuellen Wert von Grundstücken und Immobilien orientiert. Gut möglich, dass diese Villenbesitzer jahrelang eine vergleichsweise niedrige Grundsteuer bezahlt haben. Die Grundsteuer soll gerechter werden. Einige werden mehr, andere weniger bezahlen.
Können Sie Eigentümern in Aussicht stellen, zum Ausgleich die Hebesätze zu senken?
Wir wissen noch nicht, wie die Reform aussehen wird und welche Effekte erzielt werden. Erst wenn das bekannt ist, können wir uns über die Höhe der künftigen Hebesätze Gedanken machen.
Ist nicht eher die Verführung groß, die Hebesätze anzuheben, beispielsweise wenn andere Steuereinnahmen einbrechen oder die Zinsen steigen?
Es gibt keinen Automatismus, die Hebesätze zu erhöhen. Ich habe betont, dass die Reform in Bremen aufkommensneutral sein soll. Dazu stehe ich. Mit oder ohne Reform – eine Erhöhung der Hebesätze in einer Gemeinde kann man nie für alle Zeit ausschließen.