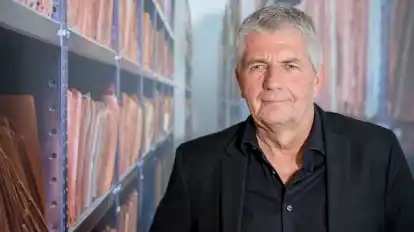Als Kugeln seine Beine durchbohren, ist Thomas Müller 21 Jahre alt. Den Abend zuvor ist er über einen Zaun aus Stacheldraht im bulgarisch-türkischen Grenzgebiet geklettert. Die bulgarischen Grenzsoldaten bemerken den Fluchtversuch. Sie suchen ihn, schießen. Zuerst in die Luft, dann auf den jungen Mann. Aus nächster Nähe. Er fällt auf den Waldboden. Hat Angst. Verliert das Bewusstsein. Kommt wieder zu sich. Schmeckt Blut.
Um zu verstehen, wie es dazu kam, muss man einige Jahre zurückgehen. 1960 als Thomas Müller in der DDR geboren, wächst er in Leipzig in einem kritisch denkenden Elternhaus auf. „Mein Vater war kein Staatsfeind, aber bei uns im Keller lief immer Deutschlandfunk“, sagt er heute. Als Siebtklässler widerspricht er dem Lehrer in Staatsbürgerkunde. Als Teenager tritt er aus der staatlichen Jugendorganisation FDJ aus. Nicht aus politischer Überzeugung. In der FDJ ist es zu eng für ihn, er will keine gemeinschaftlich verordnete Freizeit. „Ich mochte diesen Einheitsbrei nicht.“ Der junge Mann will reisen. Träumt von der Welt. Doch wie die meisten anderen DDR-Bürger darf er den Ostblock nicht verlassen. Schon bald stellt er fest: Seine Welt hat viele Grenzen. Unüberwindbare. Das will er nicht akzeptieren. Heute lebt der 59-Jährige mit seiner Frau in Bremen. Er heißt mittlerweile Thomas von Grumbkow. Seit September 1981 hat er nur noch ein Bein.
Zunächst schafft er es jedoch, sich in der sozialistischen Wirklichkeit einzurichten. Er lernt Stahlbaumonteur, verdient gut. Legt manchmal als DJ auf, hat viele Freunde. „Klar war das ein blödes Land“, sagt er, „aber ich hatte meine Nische darin.“ Während von Grumbkow erzählt, lacht er immer wieder, auch mal über sich. Es fällt leicht, ihm zuzuhören. Er spricht unterhaltsam, benutzt viele Gesten.
Mit 14 fährt er das erste Mal per Anhalter aus seiner Heimatstadt Leipzig aufs Land zur Datscha der Eltern. Und ist begeistert. Er trampt durch die DDR, als er älter wird, durch den ganzen Ostblock. Das Schönste daran: frei sein. „Morgens aufwachen, unterwegs sein und nicht zu wissen, wo man landet. Das war für mich faszinierend.“ Es folgen viele weitere Reisen. Immer ohne festes Ziel. In Budapest lernt er Tramper aus dem Westen kennen. Sie fahren weiter, einige wollen sogar nach Indien. „Das hat richtig im Bauch gezogen.“ Für von Grumbkow geht es nur bis an das Schwarze Meer.

Vor seiner Flucht ist Thomas von Grumbkow viel durch den Ostblock getrampt.
Er denkt an Flucht, sagt sich: „Du musst es jetzt machen, wenn du jung und ledig bist, sonst wirfst du es dir ein Leben lang vor.“ Wenigstens versuchen. Im Sommer 1981 ist die Wende noch weit weg, ein Ende der DDR nicht absehbar. Von Grumbkow hat gehört, die bulgarisch-türkische Grenze sei nicht so streng bewacht wie die deutsch-deutsche. Genau weiß er es nicht. „Man konnte niemanden fragen. Allein die Vorbereitung war ja strafbar.“ Wie die Male zuvor trampt er in den Urlaub nach Bulgarien. Als er losfährt, weiß er noch nicht, ob er tatsächlich fliehen wird. Nur einem Kumpel hat er von seinen Plänen erzählt. Von allen anderen hat er sich nicht verabschiedet.
Zwei Wochen verbringt der damals 21-Jährige in Bulgarien, macht Urlaub, geht schwimmen, trifft einen Freund aus Deutschland. Sie feiern Abschied in dem Küstenörtchen Achtopol. Am 5. September bricht von Grumbkow auf. Den ganzen nächsten Tag ist er im Wald unterwegs, erzählt er. Immer vorsichtig. Nicht zu laut sein. Als eine Schafsherde an ihm vorbeizieht, versteckt er sich. In der Nähe könnte ein Schäfer sein. Jemand, der ihn verraten könnte.
Nachmittags kommt er an einen Zaun. Dieser steht noch ein Stück weg von der eigentlichen Grenze. Er ist aus Stacheldraht und hoch. Von Grumbkow versucht trotzdem, auf die andere Seite zu kommen. Zieht die langen Ärmel seines Pullis und seiner Jacke über die Hände. Klettert. „Ich war sehr sportlich und hab‘ das aber nicht geschafft.“ Er läuft zurück in den Wald. Kauert im Unterholz. Denkt nach. „Ich hatte keine Feile oder Zange dabei.“ Jetzt zurückgehen? Die Flucht vergessen? Sollen der lange Marsch, die Angst umsonst gewesen sein? „Ich habe mit mir gerungen und dann gedacht, ich versuch‘ es nochmal.“ Gegen 19 Uhr geht er wieder zum Zaun. Es dämmert. Von Grumbkow schafft es mit letzter Kraft auf die andere Seite. „Hinter dem Stacheldraht war ein Sandstreifen. Wahrscheinlich waren dort Stolperdrähte. Ich habe ein Signal ausgelöst und das selbst aber nicht gemerkt.“
Einen Moment lang glaubt von Grumbkow, er sei unbemerkt über den Zaun gekommen. Dann hört er von hinten zwei Lkw. Auf den Ladeflächen sind Soldaten. „Ich bin ins Gebüsch gehechtet und die sind dann an mir vorbeigefahren.“ In der Dunkelheit konnten die Grenzer ihn nicht erkennen, meint er. Von Grumbkow ist in der Falle. „Ich habe die ganze Nacht da gesessen und überlegt. Habe dann versucht, mich durch den Wald wegzubewegen.“ Er geht davon aus, dass die Soldaten nur ein Teilgebiet gesichert haben. Hofft, robbend aus dieser Gegend kriechen zu können.

Heute spricht von Grumbkow offen über seine Erlebnisse.
„Es war unmöglich, sich leise zu bewegen.“ Auf dem Boden liegt Laub. Äste knacken unter ihm. Die Soldaten müssen von Grumbkow gehört haben. „Und ich habe Hunde gehört.“ Kurz darauf knallt es laut. Wenige Meter vor ihm steht ein Offizier mit einer Pistole in der Hand. Der Mann fuchtelt mit der Waffe. Richtet sie auf den jungen Mann. Schreit, erinnert sich von Grumbkow. Er selbst ist sprachlos. Reißt die Hände hoch. „Ich hätte einfach nur etwas rufen müssen.“ Doch er bleibt stumm. Zu groß der Schock, die Angst. Er zittert. „Ich habe tierisch Schiss gehabt. Da denkt man nicht viel.“
Wenige Sekunden später kommen weitere Soldaten. Sie rufen etwas. In den Händen halten sie Waffen. Von Grumbkow versteht sie nicht, hält seine Hände immer noch oben. Später erfährt er, dass er sich hätte hinlegen sollen. „Der eine Soldat kam von rechts angerannt. Hat etwas gebrüllt und in dem Moment hab‘ ich das Mündungsfeuer gesehen.“ Von Grumbkow gestikuliert beim Erzählen. Deutet mit seinen Armen an, wie der Soldat vor ihm stand. Wie er seine Waffe auf ihn richtete. Wie der Grenzer sich leicht drehte und feuerte. „Er hat mir in die Beine geschossen und dann lag ich im Dreck.“ Von den Kugeln getroffen, fällt von Grumbkow auf den Waldboden. Er verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, hat er Blut im Mund. Ihm fehlt ein Zahn. Eine Kugel hat seine rechte Wade durchschossen, eine andere ging durch den Oberschenkel. Die Soldaten versorgen ihn notdürftig. Laden von Grumbkow auf ihren kleinen Lkw. Fahren los. „Auf dem Jeep haben sie mich verhört.“ Von Grumbkow verliert immer wieder das Bewusstsein. Erinnert sich nur noch bruchstückhaft. Erst im Krankenhaus in der Stadt Burgas kommt er zu sich.
Nach 13 Uhr zeigt die Klinikuhr in der Notaufnahme, erinnert sich von Grumbkow. Sieben Stunden seien die Soldaten mit ihm durch die Gegend gefahren. Bakterien waren in die Wunde gelangt. Wundbrand. „Ein Arzt sprach Deutsch und der hat mir erklärt – du hast da eine Entzündung und wir müssen amputieren.“ Zunächst hieß es, nur der Unterschenkel solle entfernt werden. Als von Grumbkow aus der Narkose aufwacht, endet sein Bein oberhalb des Knies. „Ich war tierisch sauer, dass das Knie ab war.“

Nach seiner Haftentlassung lebt Thomas von Grumbkow noch anderthalb Jahre in der DDR. Lange Zeit noch hat er keine Prothese für sein amputiertes Bein.
Nach zwei Monaten im Krankenhaus muss von Grumbkow zurück in die DDR. Stasi-U-Haft in Leipzig. Vier Monate. Einzelzelle. Isolationshaft. Später sind sie zu zweit in einer Zelle. Auch der andere ist ein sogenannter Republikflüchtling. Er wundert sich, dass von Grumbkow sich als Einbeiniger zur Flucht entschlossen hat. „Du Blödmann, ich bin auf zwei Beinen losgelaufen“, sagt von Grumbkow. Sie verstehen sich trotzdem. Das Schicksal verbindet. Es folgen viele Verhöre, mehrere am Tag. Dann passiert tagelang wieder nichts. Schließlich wird er vor Gericht gestellt: ein Jahr Freiheitsstrafe. Die restlichen sechs Monate verbringt von Grumbkow in Brandenburg. Zwölf Quadratmeter Zelle, neun Personen. Drei Stockbetten à drei Etagen. Zwei kleine Schränke, ein Tisch, vier Stühle. Essen, trinken, waschen: Alles passiert in diesem Raum. „Das Schlimmste war das Klo mitten im Raum ohne Abtrennung.“
Von Grumbkow hofft, wie viele andere politische Häftlinge, vom Westen freigekauft zu werden. Vergeblich. Er wird 1982 in die DDR entlassen. Er schließt sich der Friedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ an, bemüht sich weiterhin um Ausreise. Keine Chance. Irgendwann beschließt er zu bleiben. „Ich hatte gemerkt, dass ich die so viel besser ärgern kann“, sagt er. Angst hat er keine mehr.

Anfangs ist Thomas von Grumbkow von Bremen ein wenig enttäuscht. Mittlerweile lebt er seit fast 36 Jahren hier.
Im Januar 1984 fährt von Grumbkow zur Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Will sich persönlich von den Listen der Ausreisewilligen streichen lassen. In der Vertretung sitzen Menschen. Von Grumbkow begreift: Das sind Botschaftsbesetzer. Sie wollen ihre Ausreise erzwingen, so wie 1989 dann viele Tausende DDR-Bürger in der bundesdeutschen Botschaft in Prag. Nur sind es 1984 Einzelne, die so versuchen in den Westen zu kommen. Von Grumbkow hadert und setzt sich dazu. Eine einmalige Chance. Abends am 24. Januar ist er im Westen. Nach nur anderthalb Tagen.

Das erste halbe Jahr in Bremen ist hart.
Eine Freundin der Mutter wohnt in Bremen. Eigentlich will von Grumbkow in eine große Stadt. Endlich was von der Welt sehen. Doch: „In Hamburg kannte ich niemanden und in Bremen kannte ich zumindest Barbara.“ Als er mit dem Zug in Richtung Hauptbahnhof fährt, ist von Grumbkow trotzdem enttäuscht. „Ich habe gedacht, das ist ja ein Dorf.“ In Leipzig war er stadtbekannt, in Bremen trifft er auf hanseatische Zurückhaltung. Das erste halbe Jahr ist hart. Irgendwann kommt er aber an, findet Freunde, geht im Viertel aus. „Das Wiener Hofcafé war meine allererste Kneipe in Bremen.“ Von Grumbkow macht eine Ausbildung, dann noch eine. Heiratet, wird Vater. Arbeitet. Lässt sich scheiden. Heiratet wieder.

Bald schon lebt sich Thomas von Grumbkow in Bremen ein.
Das Reisen ist in all den Jahren auf der Strecke geblieben. Mit seiner zweiten Frau plant von Grumbkow nun die Rente. In zwei Jahren ist es soweit. Die beiden haben sich in Brandenburg einen alten Hof gekauft. Dort wollen sie die Sommer verbringen. Und im Winter durch die Welt ziehen. „Meine Frau und ich haben immer noch dieses Reisefieber.“ Als junge Menschen konnten sie ihre Reiselust nicht ausleben. „Jetzt als Rentner wollen wir das nachholen.“ Endlich keine Grenzen mehr.
Erinnern an das, was war
Als die Berliner Mauer fällt, lebt Thomas von Grumbkow bereits seit fast sechs Jahren in Bremen. In die DDR durfte er seit seiner Flucht in den Westen nicht einreisen. Freunde, Familie hat er seitdem nicht gesehen. „Erst konnte ich nicht raus, und dann nicht rein. Verrückt.“ Wie viele andere sitzt er an dem Abend des 9. November gebannt vor dem Fernseher. „So was gibt es nur einmal in der Geschichte“, sagt er. „Das war Wahnsinn.“
Auch davon erzählt er, wenn er in Schulen als Zeitzeuge auftritt. Viel mehr gehe es aber natürlich um seinen Fluchtversuch im September 1981 und die unmittelbare Zeit danach. Für die Schüler ist die deutsche Teilung Stoff aus dem Geschichtsbuch. „Die kennen die DDR nur aus Erzählungen.“ Indem von Grumbkow vor ihnen steht, schafft er einen Bezug zur Gegenwart. Er will einen Austausch schaffen, Raum für Diskussionen bieten. „Ihr könnt mich alles fragen“, sagt er ihnen.
Auch er selbst nimmt bei den Schulbesuchen viel mit. Die Zeitzeugen-Arbeit ist ihm sehr wichtig: „Jedes Mal wieder neu und spannend, weil ich bei diesen Gesprächen immer wieder kleine neue Erkenntnisse habe.“