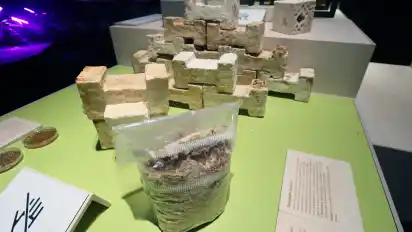Bär, Wolf, Luchs, Fischotter und Biber, aber auch Seeadler, Kaiseradler, Rotmilan und Rohrweihe: Sie alle sind in Europa streng geschützt, und dennoch werden sie aus unterschiedlichen Gründen vergiftet, erschlagen oder erschossen. Allein in Deutschland sind seit 2005 mehr als 2400 getötete Greifvögel aktenkundig. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und schätzen die tatsächliche Zahl auf das Zehnfache.
Die illegale Verfolgung ist damit wahrscheinlich die häufigste Todesursache. Auch bei den großen Säugetieren nehmen die Meldungen illegaler Tötungen zu. 13 Partner aus Deutschland und Österreich, darunter die Universität Bremen, haben sich deshalb zum Projekt "Wildlifecrime" zusammengeschlossen. Sie wollen Wege aufzeigen, wie sich die Wildtierkriminalität verringern lässt, um gefährdete Arten besser zu schützen.
Was sind die Gründe?
"Die Gründe sind sehr unterschiedlich", berichtet Sönke Gerhold, der an der Universität Bremen zu Tier- und Tierschutzrecht forscht. "Manche Jäger sehen in den Tieren eine Konkurrenz, für Geflügelzüchter und Weidetierhalter sind sie eine gefühlte Bedrohung." In anderen Fällen gehe es um wirtschaftliche Interessen bei Bauanträgen: "Wenn eine bedrohte Art dort lebt, darf nicht gebaut werden. Wenn das Tier weg ist, dann schon – und keiner weiß, wie es passiert ist." Nicht zuletzt spielt die Lust auf Trophäen eine wichtige Rolle. "Wildtierkriminalität umfasst aber nicht nur Tötungen, sondern etwa auch Brutstörungen; alle Straftaten zu Lasten von besonders geschützten Tieren."
"Die Tötung ist verboten, aber wer sich nicht daran hält, kann recht sicher sein davonzukommen", sagt Gerhold. Dafür gebe es mehrere Ursachen. Zunächst ist es für Laien, die ein totes Tier finden, nicht einfach zu entscheiden, ob ein Verbrechen vorliegt: Woran erkenne ich, ob es ein Siebenschläfer oder eine Maus ist? Welche Art ist geschützt, welche besonders streng geschützt? Was sind die Indizien, ob ein Tier an Altersschwäche, Krankheit, Gift oder einem Schuss gestorben ist?
"Oft geht es um Spuren, die schnell verschwinden, und darum, die Spuren vor Ort zu sichern", erklärt der Forscher. "Wird ein Greifvogel mit Nahrungsresten am Schnabel oder Verfärbungen im Schnabelbereich gefunden, deutet das zum Beispiel auf Vergiftung hin. Der Kadaver darf dann keinesfalls angefasst werden." Im Forschungsprojekt sollen Kriterien für die Polizei wie für die Bevölkerung zusammengestellt werden, damit bei einem Wildtierfund Kriminalität leicht erkannt werden kann.
Warum sind die Verbrechen schwer aufzuklären?
„Die Taten werden meist in freier Wildbahn und häufig nachts begangen“, weiß Gerhold. Theoretisch könnte man zum Beispiel untersuchen, welches Mobiltelefon nachts als wahrscheinlich Einziges an der Fundstelle mitten im Wald in einen Mobilfunkmast eingeloggt war. "Wir schauen uns daher im Projekt an, was rechtlich möglich ist und was noch nicht versucht worden ist."
Werde ein Luchs im Wald getötet, dort vergraben und die Patronen wieder eingesammelt, dann gebe es allerdings kaum objektive Beweismittel. "Aber Personen reden über ihre Taten, wo sie sich sicher fühlen, oder machen Andeutungen, es gebe jetzt ein Problem weniger", schildert der Jurist. Weil viele Menschen den Frieden in der Nachbarschaft nicht gefährden wollen oder Sorge haben, aus der Jagdgemeinschaft verstoßen zu werden, zeigen sie die Tat jedoch nicht an.
"Aber wann immer ein Wildtierverbrechen zur Anzeige kam, ging das auf einen Hinweis aus der Bevölkerung und anschließende Durchsuchungserfolge zurück", berichtet Gerhold. Er plädiert deshalb für mehr anonyme Möglichkeiten, Wildtierkriminalität zu melden. Einige gibt es bereits, und das Forschungsprojekt bietet auf seiner Website www.wildlifecrime.info jetzt eine weitere. Am Beispiel Luchs hat sich ein Team der Uni Bremen die Strafverfolgung schon einmal näher angesehen: "Die Behörden haben die Taten überwiegend ernst genommen und motiviert ermittelt", versichert Gerhold. "Aber oft wussten sie nicht so richtig, was sie tun sollen oder können."
"Es gibt Strafnormen und Bußgeldnormen, im Bundesnaturschutzgesetz, im Tierschutzgesetz, im Jagdgesetz, im Waffengesetz und auch im Strafgesetzbuch", zählt Gerhold die zahlreichen rechtlichen Möglichkeiten auf. Von Geldstrafen in Höhe von fünf Tagessätzen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe reichen die möglichen Sanktionen. Auch die Strafprozesse hat sich ein Team der Uni Bremen am Beispiel Luchs angesehen. Das Fazit: In Deutschland ist noch nie jemand rechtskräftig für die Tötung eines Luchses verurteilt worden.
Was ließe sich verbessern?
Ein großes Problem sieht Gerhold darin, dass im Jagdgesetz der Besitz von Trophäen erlaubt ist. Demnach dürfte sich ein Jäger einen Luchs als Trophäe ins Kaminzimmer stellen, wenn das Tier bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ob das Tier wirklich so zu Tode gekommen ist oder erschossen wurde, lässt sich kaum überprüfen.
Das Europarecht sagt zudem, dass man geschützte Tiere, und damit auch deren Trophäen, nicht besitzen darf. "Dieses Recht wird oft nicht umgesetzt", weiß der Jurist. "Wenn die Jagdlobby sagt, laut Jagdrecht darf ich den Luchs besitzen, dann muss die Polizei sich gut auskennen, um zu wissen, dass der Vorrang aus dem Europarecht greift." Gerhold fordert daher eine Klarstellung, dass Trophäen streng geschützter Arten nicht besessen werden dürfen.
Sinnvoll fände der Forscher es zudem, den Artenschutz nicht über Positivlisten zu definieren. "Diese Kataloge der geschützten Arten sind unglaublich lang und für verschiedene Straftaten unterschiedlich." Einfacher fände er Negativlisten: Alle Tiere sind streng geschützt, sofern sie nicht explizit ausgenommen sind. "Dann müsste man bei einem Tier, das man nicht kennt, zunächst davon ausgehen, dass es streng geschützt ist, und hätte sofort die Pflicht zu ermitteln." Umso besser, wenn es sich dann als nicht bedrohte Art herausstellt.