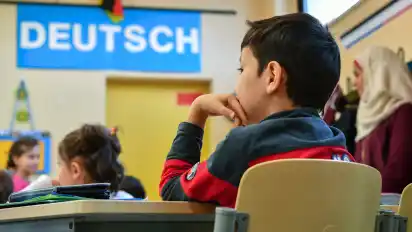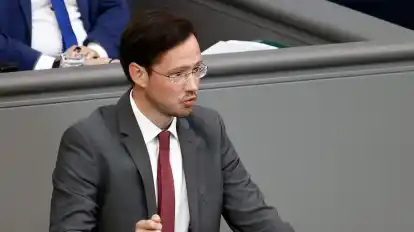Auf einhellige Ablehnung stößt der Vorschlag des Lehrerverbands, den Migrationsanteil in Schulen durch eine Quote zu begrenzen. Zur Begründung hatte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt, ab einem Anteil von 35 Prozent von Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse nähmen "die Leistungen überproportional" ab. Selten habe er zum neuen Jahr "so einen groben Unfug" gehört, sagt Martin Stoevesandt, Sprecher des Zentralelternbeirats (ZEB). Von einem "typischen Meidinger" spricht CDU-Bildungsexpertin Yvonne Averwerser. Wenig Verständnis für Meidingers Vorstoß bringt auch ihre FDP-Kollegin Birgit Bergmann auf. Ihr Kommentar: "Das geht ja schon fast in eine rassistische Richtung."
Eine klare Absage erteilt die Bildungsbehörde der Migrationsquote. "Vielleicht sollte Herr Meidinger die Realität zur Kenntnis nehmen", sagt Ressortsprecherin Maike Wiedwald. Die Realität an Bremer Schulen: ein relativ hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte, der eine Umverteilung als geradezu absurd erscheinen lässt. "In jeder Schulform liegt die Quote deutlich über 35 Prozent", sagt Wiedwald. Das belegen Zahlen, die das Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB) erhoben hat. Danach hatten 60,6 Prozent der stadtbremischen Grundschüler im Schuljahr 2021/22 einen "Migrationshinweis". In den Oberschulen lag die Quote bei 58,7 Prozent, in den Gymnasien bei 45,4 Prozent.
Unter solchen Voraussetzungen eine Quote einzuführen, würde laut Bergmann in einer "schönen Kutschiererei" münden. Auch Stoevesandt macht auf die praktischen Folgen aufmerksam. Übertragen auf Bremer Verhältnisse würde die Umsetzung bedeuten, Brennpunktschüler in eher bürgerliche Stadtteile zu bringen und "gleichzeitig Schüler aus Schwachhausen nach Gröpelingen und Osterholz zu karren". Die Quotenidee ist aus seiner Sicht ein alter Hut, sie stamme aus den USA der 1960er-Jahre. Mit dem sogenannten Busing – gemeint sind Bustransporte – habe man Kinder und Jugendliche aus innerstädtischen Schulen in Vorortschulen gebracht und umgekehrt. Doch davon sei man längst wieder abgerückt.
Statt Schülerinnen und Schüler umzuverteilen, fordert Stoevesandt die Abordnung verbeamteter Lehrkräfte in unterversorgte Schulen. Wer sich als Staatsdiener verpflichte, komme in den Genuss einer Beamtenbesoldung. "Und dann soll man mich nicht mal für zwei Jahre nach Gröpelingen abordnen können?" Aus seiner Sicht müsste im Gegenzug eine Besoldungszulage fällig werden. Lehrerabordnungen gehören auch zur Lösungsstrategie der CDU. "Der Beamtenstatus muss auch für irgendetwas gut sein", sagt Averwerser. Im Herbst habe man dazu eine Kleine Anfrage an die Bildungsbehörde gerichtet, bisher aber keine Antwort erhalten.
Auch eine der Koalitionsparteien will das heiße Eisen anrühren. "Ich glaube, dass wir über Lehrerabordnungen sprechen müssen", sagt Miriam Strunge, bildungspolitische Sprecherin der Linken. An bestimmten Schulen sei der Lehrermangel nun einmal höher als an anderen Schulen. Deshalb sei es wichtig, verschiedene Aktivierungsformen in Erwägung zu ziehen. Allerdings stoßen Lehrerabordnungen auf wenig Gegenliebe in der Bildungsbehörde. "Lehrerabordnungen sind nicht in der Diskussion", sagt Ressortsprecherin Wiedwald. Nur in Ausnahmesituationen und auf freiwilliger Basis wie jüngst im Falle der Grundschule Sodenmatt will sich die Behörde darauf einlassen.
Dahinter steckt nicht zuletzt die Befürchtung, im Ringen um Lehrkräfte wertvollen Boden zu verlieren. Explizit weist Wiedwald auf mögliche Nachteile in der schwierigen Wettbewerbssituation hin. Bergmann gibt ebenfalls zu bedenken, dass bei Abordnungen die Anstellung etwa in Niedersachsen attraktiver sein könnte. Lehrerabordnungen seien ein "heikles Instrument". Die Bildungsbehörde will deshalb mit anderen Mitteln den Personalbedarf an den Schulen decken. Zum Beispiel mit der neuen Kampagne "Back to School", die sich an Quereinsteiger mit Masterabschluss richtet. Ein weiterer Baustein: die Doppelbesetzung im Unterricht mit einer Lehrkraft und einer Erzieherin oder einem Erzieher.
Zugleich will die Behörde nicht an der bisherigen Verteilungspraxis von Kindern und Jugendlichen an Schulen rütteln. Für Grundschüler sollen die Schulwege möglichst kurz gehalten werden, sie besuchen daher die nächstgelegene Schule. Bei weiterführenden Schulen besteht grundsätzlich freie Schulwahl, aber keine Garantie für den Besuch der Wunschschule. Mit Meidingers Quotenidee würde dieses Prinzip ausgehebelt. "Grundsätzlich haben Schülerinnen und Schüler das Recht, an jeder Schule Unterricht zu bekommen", sagt Wiedwald.
Als schwierig würde sich auch erweisen, den "Migrationshintergrund" zu definieren. "Was ist, wenn es in einer Klasse 35 Prozent Schweden oder Österreicher gäbe?", fragt Bergmann. Für die linke Bildungspolitikerin Strunge liegt auf der Hand, dass Meidingers Äußerungen im Kontext der Silvesterdebatte um aggressive und bildungsferne Jugendliche mit Migrationsgeschichte zu verstehen sind. Sie spricht von einem diskriminierenden und populistischen Manöver. Damit befindet sie sich in voller Übereinstimmung mit den anderen Akteuren. "Das Problem ist die Bandbreite der Leistungsfähigkeit, nicht der Migrationshintergrund", sagt Bergmann. Oder, wie es Wiedwald formuliert: "Wir brauchen so eine Diskussion nicht."