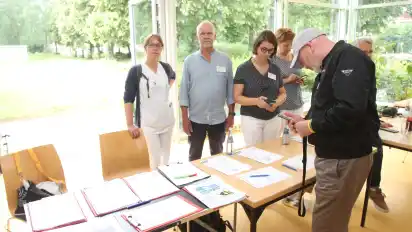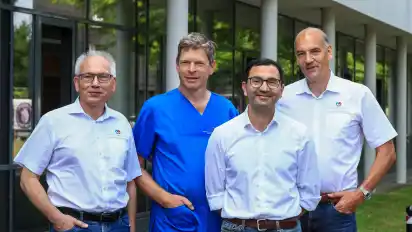Für das Klinikum Links der Weser (LdW) schlägt am Freitag die Stunde der Wahrheit. Dann wird der Aufsichtsrat des städtischen Krankenhausverbundes Gesundheit Nord (Geno) eine Empfehlung zur Zukunft des Standortes aussprechen. Der Vorschlag der Geschäftsleitung ist klar. Er lautet: "Einstellung des Krankenhausbetriebs." So steht es in der Beschlussvorlage.
Mögliche ambulante Auffanglösungen für die medizinische Versorgung in Obervieland zeichnen sich bisher nur schemenhaft ab. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken ist von einer "Grundversorgung" die Rede, die am bisherigen LdW-Standort gesichert werden soll. Beschließt der Aufsichtsrat im Sinne der Geschäftsleitung, wird der Senat im Herbst eine endgültige Entscheidung treffen. Er tut das dann sozusagen als Eigentümer, denn die Geno mit ihren vier Häusern in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser gehört zu 100 Prozent der Stadtgemeinde.
Hintergrund der bevorstehenden Weichenstellung ist die seit vielen Jahren andauernde wirtschaftliche Schieflage der Geno. Die Stadt hat immer wieder hohe Millionenbeträge in den Krankenhausverbund gepumpt, ohne eine durchgreifende Verbesserung zu erreichen. Die Rahmenbedingungen haben sich zwischenzeitlich eher noch verschlechtert – vor allem durch den gravierenden Fachkräftemangel im Pflegebereich.
Geno steht am Scheideweg
Er bewirkt, dass die vier Häuser gar nicht so viele Behandlungen erbringen können, wie es von der Bettenzahl und der technischen Ausstattung her möglich wäre. Gleichzeitig setzt der Trend zu mehr ambulanten Therapien den stationären Einrichtungen zu. Die Geno steht deshalb am Scheideweg. Ein Satz in der Beschlussvorlage bringt das auf den Punkt: "Mit dem aktuellen und zukünftig prognostizierten Leistungsvolumen sind die vier klinischen Standorte in der derzeitigen Größenordnung nur zu 60 bis 65 Prozent ausgelastet und somit nicht nachhaltig ökonomisch und ökologisch betreibbar."
Plan: 500 Betten abbauen
Vor diesem Hintergrund hatte die Geno-Spitze bereits im Frühjahr angekündigt, etwa 500 der derzeit vorhandenen 2000 Betten im Verbund abzubauen. Dass LdW rückt dabei nicht zufällig in den Fokus. Sein baulicher Kern – das Bettenhaus – gilt als stark sanierungsbedürftig. Ein weiterer Faktor ist die auf Bundesebene geplante Krankenhausstrukturreform. Sie sieht neben Kliniken der Grundversorgung und Fachkliniken auch sogenannte Maximalversorger vor, die alle medizinischen Disziplinen auf höchstem Niveau anbieten.
Das Klinikum Bremen-Mitte (KBM) wäre im Grundsatz ein solches Haus. Es fehlt dort aber noch die Herzmedizin, die gegenwärtig am LdW angesiedelt ist. Mit dem Umzug der Kardiologen nach Mitte ließe sich ein solcher Maximalversorger schaffen. Das Jahr 2028 gilt hierfür als Zielmarke. Allerdings ist der Beschluss, der am Freitag voraussichtlich gefasst wird, weitreichender. Es würde nicht nur das Herzzentrum umziehen. Betroffen wären auch die Notfallaufnahme, die Allgemein- und Unfallchirurgie, die Innere Medizin, kurz: alles, was jetzt noch an stationären Behandlungsangeboten vorhanden ist.
Die im Koalitionsvertrag eher unpräzise als "Grundversorgung" angekündigte Anschlusslösung könnte ein neuartiges Konstrukt irgendwo zwischen Arztpraxis und Krankenhaus sein. Beispielsweise ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit angestellten Ärzten verschiedener Fachrichtungen, die zwar nicht rund um die Uhr, aber auch in Randzeiten eine Basisversorgung für die Bevölkerung im Bremer Süden anbieten würden. "Solch eine Struktur könnte man parallel zur Verlagerung des LdW aufbauen", sagt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard.
Geno hat weiter Finanzprobleme
Doch selbst wenn durch Kapazitätsabbau und Konzentration auf drei Standorte eine wirtschaftliche Stabilisierung gelingt, werden die finanziellen Probleme der Geno keineswegs ausgestanden sein. Auch das geht aus den Unterlagen für den Aufsichtsrat hervor. Selbst ohne zwei benötigte Neubauten auf dem Gelände des KBM und des Klinikums Ost (Berufsakademie, Forensik) besteht ein baulicher Modernisierungsbedarf im Wert von fast 1,1 Milliarden Euro. Knapp 420 Millionen Euro davon könnten durch Fördermittel abgedeckt werden. Gebraucht werden darüber hinaus noch 160 Millionen Euro an Liquiditätshilfen bis 2027 und die Übernahme einer Schuldverschreibung von 100 Millionen Euro durch die Stadt. Unterm Strich existiert damit ein Mittelbedarf von 935 Millionen Euro bis zum Jahr 2032. In der Gesundheitsbehörde weiß niemand, woher so viel Geld kommen soll.