Wann haben Sie sich zuletzt gelangweilt?
Silke Ohlmeier: Zuletzt war das bei meinem Umzug nach Hannover der Fall. In dieser Phase habe ich mich, weil wir noch keinen Kitaplatz hatten und mein Mann einen neuen Job begonnen hat, Vollzeit um meinen Sohn gekümmert. Dazu kannte ich noch wenig Leute hier. Prinzipiell verbringe ich zwar gerne Zeit mit meinem Sohn, aber wenn diese Aufgabe zu viel Raum einnimmt, wenn zu wenig selbstbestimmte Zeit für mich übrig bleibt, langweile ich mich.
Sehr langweilig war Ihnen auch in Ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau in einem Busunternehmen. Was war da los?
Ich bin in diese Ausbildung reingestolpert. Die Ausbildung und ich, das passte nicht zusammen. Ich hatte kein Interesse an der Branche, und die Arbeit in einem Büro hat auch nicht meinen Fähigkeiten entsprochen. Ich habe mir darüber aber vorher gar keine Gedanken gemacht.
Worüber stattdessen?
In meinem Umfeld ging es eher um die Frage, wie ich einen sicheren und soliden Job finden kann.
Wie haben Sie Ihre Arbeitstage erlebt?
Ich hatte wenig zu tun, gleichzeitig waren die Arbeitszeiten sehr starr. Ich hatte jeden Tag von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr am Schreibtisch zu sein, dabei wusste ich gar nicht, wie ich den Tag füllen sollte mit den Aufgaben, die ich hatte.
Was waren Ihre Aufgaben?
Lieferscheine sortieren, Rechnungen abheften, Briefe eintüten, selten auch mal komplexere Aufgaben.
Wie haben Sie die Zeit rumgekriegt?
Ich habe damals leider eine sehr kurzfristige Strategie angewendet. Ich habe versucht, mich von der Langeweile abzulenken. Da die meisten Internetseiten gesperrt waren, war Surfen im Netz keine Option. Ich habe stattdessen E-Mails an Azubi-Kollegen geschickt. Ich bin häufiger als nötig zur Toilette gegangen. Ich habe Brötchen für die Belegschaft gekauft. Ich habe versucht, aus dem Sortieren der Lieferscheine ein Spielchen zu machen, um irgendwie durch den Tag zu kommen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jeder Tag die Hölle gewesen sei. Warum haben Sie trotzdem weitergemacht?
Wenn ich die Langeweile wirklich hätte bewältigen wollen, hätte ich die Ausbildung abbrechen müssen. Aber das war keine Option für mich.
Warum nicht?
Da sind wir schon bei der Soziologie. Gesellschaftliche Normen und Erwartungen spielten eine entscheidende Rolle: dass man eine Ausbildung nicht abbricht; dass das schlecht aussieht im Lebenslauf; dass es schwieriger wird, einen neuen Job zu bekommen. Ich hatte verinnerlicht: Das, was man anfängt, muss man auch durchziehen.
Heute schreiben Sie an Ihrer Doktorarbeit im Fachbereich Soziologie. Wie ist es dazu gekommen?
Nach meiner Ausbildung war für mich klar: Jetzt ist Schluss! Ich möchte mich nicht weiter langweilen. Langeweile ist ein unangenehmes Gefühl und kann einem den Impuls geben, etwas zu verändern. Also habe ich mich hingesetzt und mich gefragt: Was interessiert dich wirklich?
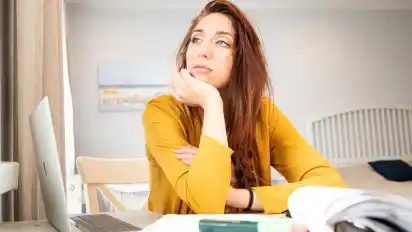
"Langeweile kennt jede und jeder, hat aber angeblich niemand, wenn man konkret danach fragt. Kein Wunder, steht sie doch konträr zum Leistungsimperativ unserer Gesellschaft", sagt Silke Ohlmeier.
Auf was sind Sie gestoßen?
Auf Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit Soziologie im Nebenfach.
Das klingt nach einer 180-Grad-Wende.
Tatsächlich hat sich das für mich nach brotloser Kunst angehört, und ich hatte damals auch die Angst: Was macht man hinterher damit? Auch die Tatsache, dass ich die Erste in der Familie war, die ein Studium angefangen hat, hat in die Unsicherheit mit hineingespielt. Nichtsdestotrotz habe ich mir, auch dank der Unterstützung meiner Eltern, gesagt: Ist mir egal, selbst wenn ich hinterher arbeitslos werde, Hauptsache, ich bin raus aus der Langeweile.
Welche Fragen stellen Sie sich heute als Wissenschaftlerin, wenn Sie zu Langeweile forschen?
Mich interessiert vor allem, wie die Gesellschaft als Ganzes dazu beiträgt, dass sich Menschen langweilen. Ich zeige in meinem Buch, dass Langeweile kein persönliches Phänomen ist, sondern dass es mit ungleichen Machtverhältnissen zu tun hat, mit einengenden Normen, mit einseitigen Weltanschauungen.
Wie definiert der Mensch Langeweile?
Eine Antwort darauf zu finden, ist gar nicht so einfach. Jemand findet Fußball langweilig, jemand anders einen bestimmten Film, den wiederum ein anderer aber spannend findet. Auch wenn Langeweile so weit verbreitet und den meisten Menschen vertraut ist, ist sie gleichzeitig schwer erkenn- und benennbar. Langeweile kennt jede und jeder, hat aber angeblich niemand, wenn man konkret danach fragt. Kein Wunder, steht sie doch konträr zum Leistungsimperativ unserer Gesellschaft und wird fälschlicherweise allzu häufig mit Nichtstun, Faulheit oder Trägheit gleichgesetzt.

Situativer Langeweile, etwa beim Warten in der Supermarktschlange vor der Kasse, begegnen wir mit Ablenkungsstrategien wie den Blick aufs Handy.
Wenn ich sonntagnachmittags auf dem Sofa liege und nichts tue…
…kann das Ausdruck von Langeweile sein. Aber es kann auch sehr entspannend sein, nichts zu tun. Entspannung ist im Gegensatz zur Langeweile ein angenehmes Gefühl. Ich möchte in dem Moment gerade gar keiner Herausforderung nachgehen, sondern meine Gedanken schweifen lassen.
Und wenn ich im Stau stehe oder an der Supermarktkasse warte?
Dann nennen wir das situative Langeweile. Jeder von uns erlebt sie fast jeden Tag. Wir schalten im Auto das Radio ein oder greifen an der Supermarktkasse zum Handy, wenn uns langweilig wird. Oder wir haben uns auf die Situation vorbereitet und ein schönes Buch eingepackt, wenn uns zum Beispiel eine lange Zugfahrt bevorsteht. Diese Form von Langeweile ist nicht kritisch.
Wann wird Langeweile gefährlich?
Wenn sie chronisch wird. Ich arbeite mit der Definition des Psychologen John Eastwood, der Langeweile als eine unangenehme Erfahrung beschreibt: Man will einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen, kann es aber nicht. Ich denke nicht, dass man Langeweile noch besser in so wenigen Worten zusammenfassen kann. Denn daraus lässt sich einiges ableiten.
Was zum Beispiel?
Im Gegensatz zur Apathie ist Langeweile kein Zustand der Gleichgültigkeit. Im Gegenteil: Langeweile ruft in uns den unbedingten Drang hervor, die Situation zu verlassen und etwas anderes, sinnvolleres zu tun – es ist nur gerade nicht möglich. Gelangweilte Menschen sind im Gegensatz zu Menschen in akuten depressiven Phasen auch nicht automatisch antriebs- oder interessenlos. Sie können ihren Interessen nur nicht nachgehen. Das empfinden sie häufig als quälend. Langeweile ist ein höchst unangenehmer Gefühlscocktail aus Müdigkeit, Stress, Unruhe und dem Gefühl, dass ein Augenblick ewig dauert.
Sie setzen sich in Ihrem Buch auch mit einigen Annahmen auseinander, zum Beispiel, dass Langeweile kreativ macht.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Langeweile nicht unbedingt kreativ macht. Das hängt von den Fähigkeiten der Person ab und auch vom Kontext. Nur weil ich mich langweile, komponiere ich kein Musikstück.

"Wir dürfen die Verantwortung für die Langeweile nicht der einzelnen Person zuschieben", lautet eine Schlussfolgerung die Langeweile-Forscherin Silke Ohlmeier zieht.
Wie kompliziert das mit der Langeweile ist, zeigen Sie auch daran auf, dass Menschen, die Fließbandarbeit erledigen, nicht automatisch anfälliger für Langeweile sind als zum Beispiel ein Rechtsanwalt.
Es wäre falsch, Langeweile nur dem Niedriglohnsektor zuzuschreiben. Die Arbeiten, denen dort nachgegangen wird, sind sehr wichtig und konkret. Ich möchte den Niedriglohnsektor nicht idealisieren, aber häufig weiß man dort, wofür man etwas tut. Eine Reinigungskraft zum Beispiel sieht, was sie geschafft hat. Außerdem ist diese Arbeit nicht so idealisiert, und die Erwartungen sind nicht so hoch.
Anders als manche Bürojobs, meinen Sie?
Es gibt Tätigkeiten, die scheinen von außen wichtig, sind es aber dann nicht wirklich. Gleichzeitig sieht man, dass alle anderen um einen herum scheinbar etwas ganz Wichtiges tun. In diesen Büros muss man in der Regel acht Stunden arbeiten, egal ob man heute überhaupt so viel zu tun hat. Viele tun dann so, als hätten sie etwas zu tun.
Und der Rechtsanwalt, über den Sie schreiben?
Einengende Normen gibt es in jeder Schicht. So wie ich damals meine Ausbildung als Industriekauffrau gewählt habe, hat er aufgrund seines Umfeldes – er kommt aus einer Juristenfamilie – das Jurastudium gewählt, würde aber lieber etwas anderes machen.
Er hätte dafür auch bessere Chancen als andere, oder?
Er hat finanzielle Ressourcen und einen hohen Bildungsabschluss. Er ist privilegiert, und das macht es leichter, nach etwas Neuem zu schauen. Wenn ich kein Geld habe, keinen guten Schulabschluss, ist es schwer, den Job zu wechseln, selbst wenn ich möchte, denn ich brauche das Geld, um meine Miete zahlen zu können.
An welchem Punkt werden die gesellschaftlichen und politischen Folgen von Langeweile sichtbar?
Sind die langfristigen und gesunden Bewältigungsstrategien blockiert, greifen viele Menschen auf eher ungesunde Bewältigungsstrategien zurück. Viele Studien zeigen, dass Langeweile Glücksspiel, Essstörungen, Alkoholsucht und Drogenabhängigkeit befördert. An der Redewendung von der tödlichen Langeweile ist etwas Wahres dran. Aber auch, wenn sie glücklicherweise meist nicht direkt zum Tod führen, sind die negativen Auswirkungen auf das körperliche und psychische Wohlbefinden massiv: Langeweile korreliert mit einer ganzen Reihe negativer Emotionen wie Angst, Einsamkeit oder Aggression.
Was sind Schlussfolgerungen, die Sie daraus ziehen?
Private Gefühle sind nicht so privat, wie wir denken. Das plakativste Beispiel ist die weibliche Langeweile, historisch betrachtet. Frauen sind jahrhundertelang ausgeschlossen worden von beruflichen Positionen, von gesellschaftlicher Teilhabe, von Bildung. Die einzige Rolle, die übrig blieb, war die Rolle als Hausfrau und Mutter. Das heißt nicht, dass Hausfrau und Mutter zu sein an sich langweilig ist. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn es das Einzige ist und nicht frei gewählt, dann ist Langeweile kein persönliches Problem im Sinne von: Diese Frauen können sich scheinbar nicht gut genug beschäftigen. Sondern dann ist Langeweile der Ausdruck von Unterdrückung, und daraus entsteht das Gefühl der Ohnmacht, des Gefangenseins.
Was ist die Konsequenz daraus?
Wenn wir Langeweile gesamtgesellschaftlich bewältigen möchten und ein nicht-langweiliges Leben für alle Menschen ermöglichen wollen, unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft oder von ihrer Leistungsfähigkeit, dann brauchen wir eine gerechtere Gesellschaft. Wir dürfen die Verantwortung für die Langeweile nicht der einzelnen Person zuschieben.
Das heißt konkret?
Bleiben wir beim Beispiel Frauen: Für Frauen, die sich in ihrer Mutterrolle langweilen, braucht es andere Entlastungsstrukturen: mehr Kinderbetreuung, eine andere Aufteilung von Care-Arbeit, aber auch den gleichen Lohn für Männer und Frauen, damit Hausarbeit und Lohnarbeit besser aufgeteilt werden kann.
Das Gespräch führte Marc Hagedorn.





