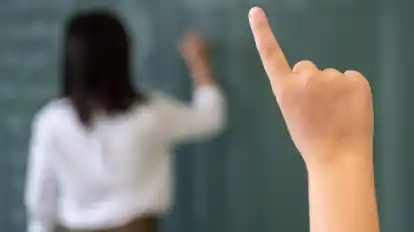Attackierte Lehrer und Polizisten, Dutzende Verletzte – eine Schlägerei an einer Schule in Berlin-Neukölln hat vor wenigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. 49 Personen erlitten Reizungen durch Pfefferspray-Einsatz, die Schulleiterin brach sich einen Finger. Kein Einzelfall. Auch in Bremen ist Gewalt gegen Lehrkräfte ein Thema.
Was ist in Bremen vorgefallen?
Unbekannte hatten an einer Schule am Waller Ring Hassbotschaften, Beleidigungen und Drohungen an die Fassade geschmiert. In der Vergangenheit wurden bereits Scheiben eingeschlagen und Eier gegen Wände geworfen. Die Bremer Polizei bestätigt, dass mehrere Anzeigen eingegangen seien. Vier Lehrkräfte wurden durch die Schmierereien persönlich angegriffen und bedroht, teils auch deren Kinder. Mitglieder des Kollegiums sind schockiert und verunsichert, sie fühlen sich alleingelassen.
Wie ist die Lage in Bremen?
Wie Aygün Kilincsoy, Sprecher der Bildungsbehörde, erklärt, seien im Schuljahr 2023/2024 fünf besondere Vorkommnisse von allgemeinbildenden Schulen an die Schulaufsicht gemeldet worden, die sich gegen Lehrkräfte gerichtet hätten. Dazu zählen Beleidigungen und Bedrohungen über soziale Medien sowie Ausraster von Kindern und Jugendlichen in Konfliktsituationen, die sich nicht beherrschen konnten und um sich schlugen. Insgesamt habe es mehr als 70 gemeldete "besondere Vorkommnisse gegeben"; der Großteil habe sich aber nicht gegen Lehrkräfte gerichtet.
Elke Suhr, Sprecherin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bremen, bestätigt, dass Gewalt gegen Lehrpersonal in Bremen bisher nicht zum Alltag gehört: "Wir nehmen zum Glück wahr, dass es sich überwiegend um Einzelfälle handelt."
Welche Entwicklung gibt es?
In Deutschland nimmt die verbale und physische Gewalt gegen Lehrkräfte zu. Das hatte Ende vergangenen Jahres eine Befragung von 1300 Schulleiterinnen und Schulleitern ergeben, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) alle zwei Jahre in Auftrag gibt. Demnach seien über einen Zeitraum von fünf Jahren 62 Prozent der Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt worden – ein Anstieg um 14 Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Erhebung.
Was sagen die Lehrer?
Diese Entwicklung sieht auch GEW-Sprecherin Elke Suhr. "Das ganze Klima in der Gesellschaft wird ja schlimmer – es wird viel schneller gepöbelt. Das spiegelt sich auch in der Schule", sagt die Lehrerin, die in Bremerhaven unterrichtet. Vorfälle wie der aktuelle in Walle ließen einen als Lehrer nicht kalt, erklärt sie. Es gebe nicht mehr dieses Gefühl, dass die Schule ein sicherer Ort sei, ein Ort des Respekts, an dem Kinder fürs Leben lernen. "Es bringt bei manchen das Gefühl nach vorne, dass man sich abschirmen muss", so Suhr. "Das macht aber die Pädagogik ganz schwierig."
Eigentlich müsste man den Schülern mehr Aufmerksamkeit widmen. Doch stattdessen müssten Lehrkräfte immer mehr leisten, was zwangsläufig zu Abstrichen führe. „Die fehlenden Investitionen in Bildung führen zu mehr Frustration – sowohl beim Personal als auch bei den Kindern“, sagt sie. Und aus der Frustration könne Gewalt entstehen.
Was sagt die Bildungsbehörde?
Laut Behördensprecher Aygün Kilincsoy ist die Anzahl der gemeldeten Vorfälle nicht signifikant gestiegen. Er verweist auf Unterstützungsangebote, etwa durch die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz) oder schulische Krisenteams. An diese Stellen könnten sich Betroffene wenden. Präventiv erarbeiteten die Schulen zudem Konzepte im Umgang mit Gewalt und Verhaltensregeln zum Umgang in Krisensituationen. Das Rebuz unterstütze Schulen in der Krisenbewältigung – etwa auch aktuell am Waller Ring. Die Mitarbeiter würden in die Schulen gehen und gemeinsam mit Schülern, Lehrern, gegebenenfalls auch Eltern an einer Lösung der Probleme arbeiten.
Reichen die Angebote?
Lehrerin Suhl lobt die Arbeit der Kriseninterventionsteams. Aus ihrer Sicht komme die Unterstützung aber oft „zu spät, zu langsam oder manchmal gar nicht“. Es brauche mehr Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen. Zudem fordert sie, alle pädagogischen Berufe attraktiver zu machen. „Es muss mehr in die Zukunft der Jugend investiert werden“, sagt sie. Sowohl in der Schule als auch außerhalb, zum Beispiel in Jugendzentren. Nur so könnten Perspektiven geboten, Frustration vermieden und erfolgreiche Prävention betrieben werden.