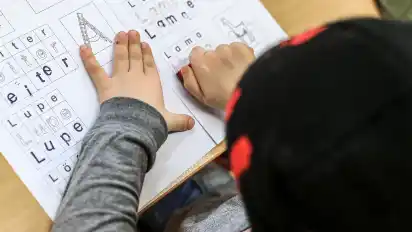"Am liebsten würde ich mit den Kindern in einer Kleingruppe den ganzen Tag draußen rumstromern." Das sagt Maike Maruck, Sprachförderexpertin der Kita Graubündener Straße in Osterholz. Himmel, Sonne, Baum – die Wörter lernen Kinder am besten, wenn sie diese Dinge selbst erkunden. Was man gemeinsam erlebt, prägt sich am besten ein, auch sprachlich, sagt Maruck.
Sie versucht, wann immer es geht, mit den Kindern rauszugehen, zum Kinderbauernhof, in die Turnhalle oder zum Rollerführerschein. Tatsächlich ist sie allerdings für gleich fünf Kleingruppen mit jeweils sechs Kindern zuständig. Jede Kleingruppe holt sie ein- bis zweimal pro Woche zusammen. Dann gibt es Sprachspiele, Erzählimpulse, oder die Kinder legen Worte mit Holzbuchstaben. Maruck arbeitet aber auch in den normalen Gruppen mit. Und nicht nur sie achtet auf die Sprache der Kinder: "Sprachförderung findet hier durch alle statt, von morgens bis abends", sagt Kita-Leiterin Kirsten Ellmers.
In der städtischen Kita in der Graubündener Straße werden knapp 100 Kinder betreut. Mehr als Dreiviertel von ihnen haben Sprachförderbedarf, sagt Ellmers. Zuletzt wurde in einem Sprachtest 27 von 32 Vorschulkindern der Kita Sprachförderbedarf bescheinigt. Osterholz gehört zu den Stadtteilen mit einer besonders hohen Quote.
Probleme ballen sich in bestimmten Gebieten
Im Schnitt werden fast jedem zweiten Kind in der Stadt Sprachprobleme attestiert. 2023 lag die Sprachförderquote bei 48 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Bremer Instituts für Qualitätsentwicklung (IQHB) hervor. Dabei gibt es besonders viele Kinder mit Sprachschwierigkeiten in bestimmten Stadtteilen: Die höchsten Quoten gebe es in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen, heißt es im IQHB-Bericht. Jedes zweite Bremer Sprachförderkind lebe entweder in Gröpelingen, der Vahr, Huchting, Osterholz oder Blumenthal. Zusätzlich gibt es besonders hohe Zahlen von Förderkindern in einigen Kitas.
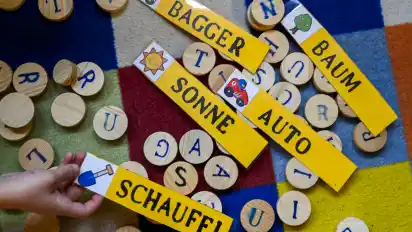
In Osterholz haben 61 Prozent der Kinder einen Sprachförderbedarf. Spielerisch können sie in der Kita viel lernen. Doch viele Einrichtungen wünschen sich dafür mehr Personal.
In der Kita Graubündener Straße hören die meisten Kinder zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Zum Beispiel Arabisch, Türkisch, Kurdisch oder Persisch, aber auch Twi, das man in Ghana spricht. "Dass die Eltern mit den Kindern ihre Herzenssprache sprechen, ist auch gut so – wer seine Herkunftssprache richtig lernt, kann später gut eine Zweitsprache lernen", sagt Maruck.
Allerdings gibt es im Alltag zwei zentrale Schwierigkeiten: Zum einen gibt es in ihrer Kita schlicht so viele Kinder mit anderer Herkunftssprache, dass erst einmal fast nur die Erzieherinnen Deutsch sprechen. "Wir haben hier kaum Sprachvorbilder", sagt Leiterin Ellmers. Beispielsweise gebe es in einer Gruppe mit 19 Kindern nur ein Kind mit deutscher Muttersprache, drei weitere, die zu Hause auch Deutsch hören und 15 die zu Hause ausschließlich eine andere Sprache hören.
Das Gebiet rund um die Kita hat zuletzt viel Zuwanderung erlebt. Hier gebe es mehr bezahlbare Wohnungen, auch für größere Familien, sagt Ellmers. Rund um die Kita sieht man Wohnblöcke mit Rasenflächen. "Wir haben aber auch viele Familien, die auf engstem Raum zusammenleben, da wohnen teils sechs Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung", sagt sie.
Und zum anderen gebe es bei vielen Eltern eine gewisse Sprachlosigkeit, stellt die Kita-Leiterin fest: "Viele Eltern gucken nur noch auf ihr Smartphone, auch wenn sie mit den Kindern unterwegs sind – und haben dann vielleicht noch Stöpsel in den Ohren." Beim Einkauf im Supermarkt dürfe das Kind im Buggy einen Film auf dem Handy sehen. "Einige Eltern sprechen auch wenig miteinander." Und das wirke sich auf die Kinder aus, die dann teilweise auch ihre Muttersprache nicht richtig lernten.
Beim Frühstück fehlen die Worte
Die Sprachprobleme werden im Kita-Alltag sichtbar. Zum Beispiel, wenn beim gemeinsamen Frühstück viele Kinder mit dem Finger zeigen, was sie möchten – weil sie es nicht benennen können. "Ein Mädchen hat heute gesagt: ,Das Gelbe da', sie kannte den Begriff Butter nicht", erzählt Maruck. "Kinder sind da erfinderisch und umschreiben." Viele Eltern seien aber auch bemüht und würden das Angebot der Kita, sich Spiele und Bücher in verschiedenen Sprachen auszuleihen, gerne nutzen.
Fakt ist: Auch wenn Bremer Kitas Sprachförderung in ihren Alltag integrieren, können die Probleme bei den meisten Kindern nicht bis zur Einschulung aufgelöst werden. Zwei Drittel der Kinder, denen im Vorschulalter Sprachförderbedarf attestiert wurden, hatten laut IQHB auch zu Beginn der ersten Klasse noch keinen altersgemäßen Sprachstand.
Maike Maruck schildert, was das für die Kinder bedeutet: "Wo meine Sprache endet, da endet auch meine Welt, da können Kinder dem Unterricht nicht folgen, sind frustriert, werden ausgegrenzt", sagt sie. "Das fördert Schulversagen und auch Verhaltensauffälligkeiten." Die Kita als erste Bildungseinrichtung müsse den Kindern das sprachliche Handwerkszeug mitgeben, ist sie überzeugt.
Gerne würde die Kita-Leitung dafür auch Logopädinnen oder Ergotherapeuten mit in ihr Team holen. Allerdings gebe es derzeit weder Stellen noch Räume dafür, sagt Leiterin Ellmers: "Es ist bei uns einfach zu voll und zu eng." Sie wünscht sich für eine bessere Sprachförderung vor allem kleinere Gruppen und mehr Fachkräfte.