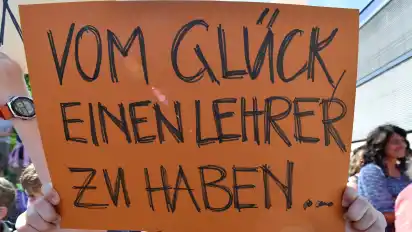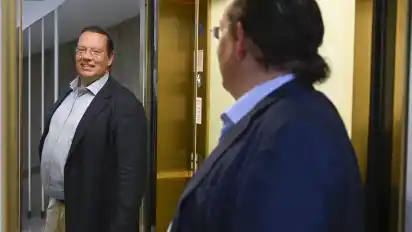Ein wenig geht es Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulepp wie den Bundestrainern der Fußballnationalmannschaften: Die Ergebnisse sind mau und alle sind zur Kritik berufen. Schließlich waren alle mal auf einer Schule und viele haben Kinder, die gerade eine Kita oder eine Lehranstalt besuchen. Warum also übernimmt man den undankbarsten aller Senatorenposten? Weil man gleichzeitig auch den wichtigsten Bereich verantwortet, quasi die Zukunft des ganzen Bundeslandes.
Aulepp scheint überzeugt, dass diese Sicht nun endlich von der kompletten rot-grün-roten Koalition getragen wird, im Senat ebenso wie in der Bürgerschaft. Und sie hofft, dass ihr das die nötige Beinfreiheit verschafft, um im Kampf gegen die Bremer Bildungsmisere ungewöhnliche oder gar neue Wege zu gehen.
Denn die Herausforderungen sind noch gewachsen: Seit 2014 ist die Zahl der Schulkinder um 14 Prozent gestiegen, zudem haben heute 34 Prozent von ihnen keinen deutschen Pass. Die Unterrichtssprache ist folglich auch nicht ihre Muttersprache. Aulepp will das möglichst früh auffangen: Wenn „Sprachförderbedarf“ festgestellt wird, soll das Kind auch zwangsweise ein Jahr vor der Einschulung in einer Kita angemeldet werden.
Für diese neue Verbindlichkeit, nötigenfalls vom Jugendamt durchgesetzt, gibt es sicher keinen Gegenwind von der konservativ-liberalen Opposition. Aber steht auch das vorgeblich progressive Regierungsbündnis, in dem Druck und Zwang oft als „Repression“ etikettiert werden, dahinter?
Neben Rückenwind braucht die frühere SPD-Landevorsitzende Aulepp vor allem Geld vom neuen grünen Finanzsenator Björn Fecker. Und jede Menge Personal von einem Arbeitsmarkt, der schon stark angespannt ist. 300 Millionen Euro will die Senatorin in die Hand nehmen, um bis zum Kita-Jahr 2028/29 insgesamt 42 neue Kitas für 5000 Kinder zu schaffen. Aber wer soll die betreuen?
Die Baby-Boomer-Generation ist in fünf Jahren zum Großteil im Ruhestand, deutlich weniger Fachkräfte rücken nach. Also müssen als Assistenzen der Erzieher auch mal Ungelernte ran, natürlich mit geringerer Besoldung. Oder Schulabgänger, die erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. Ein pragmatischer Ansatz, aber tragen den auch immer anspruchsvollere Eltern mit? Vermutlich, wenn die Alternative „gar kein Kita-Platz“ heißt. Und werden die Gewerkschaften nicht sofort klagen, dass so durch den Einsatz von Billigkräften Bildungsstandards geschleift würden?
Mit Feckers Vorgänger Dietmar Strehl konnte die Senatorin verabreden, bei der Kita-Planung vom tatsächlichen Bedarf auszugehen. Das heißt, abgelehnte Kinder bleiben auch dann erfasst, wenn ihre Eltern keinen erneuten Antrag stellen. Und es wird ein Puffer eingerechnet, weil 2022 rund 15 Prozent der Kinder gar keine Kita besuchten – aber das soll ja nicht so bleiben.
Leider setzen sich die personellen und finanziellen Probleme dann an den Schulen fort. Aktuell fehlten mindestens 15 Schulen, rechnete der scheidende Vorsitzende des Zentralen Elternbeirats (ZEB) Anfang Juli vor. 350 bis 450 Millionen Euro müssten investiert werden, sagt Martin Stoevesandt. „Mit Sanierungsstau sind wir weit über eine Milliarde Euro.“ Im Nachtragshaushalt für 2023 schlummert immerhin noch eine halbe Milliarde Euro, die bislang nicht verplant ist – aber ob die Schulsenatorin da rankommt?
Leichter erscheint es an den Schulen, die personellen Lücken zu verringern. Das liegt zum einen daran, dass mittlerweile fast 92 Prozent der Bremer Lehrkräfte verbeamtet sind. Damit können sie – im Gegensatz zu öffentlichen Angestellten – auch „abgeordnet“ werden: etwa an die Grundschule Mahndorf, wo vor den Ferien jede vierte Stelle unbesetzt war. Oder an die Vegesacker Grundschule am Wasser, wo zuletzt wochenlang der Deutschunterricht ausfiel. Nach anfänglichem Widerstand scheint Aulepp nun willens zu sein, dieses beamtenrechtliche Mittel doch noch auszureizen – auch gegen Widerstände in Partei und Gewerkschaften.
Deutlich besser als erwartet läuft offenbar das Projekt „Back to school“, über das Seiteneinsteiger für den Lehrerberuf gewonnen werden sollen. Inzwischen liegen 480 Bewerbungen von Berufstätigen vor, die über Qualifikationen verfügen, um zumindest ein Schulfach zu unterrichten. 83 Einstellungen hat es bislang gegeben. „Zum neuen Schuljahr knacken wir die 100“, gab Aulepp jüngst als Nahziel vor. Da bislang kaum Kritik an diesem Projekt laut wurde, spricht alles für eine Fortführung. Zudem sollen Ruheständler in die Klassenräume zurückgelockt und aktive Pädagogen zur Mehrarbeit ermuntert werden – natürlich mit Mehrbezahlung.
Doch unterdessen ist einer der wenigen schulpolitischen Erfolge schon wieder bedroht. Als wegen der Corona-Pandemie sämtliche Bremer Schüler einheitlich mit iPads ausgestattet wurden, war man allen Bundesländern voraus. Die Vorteile liegen auf der Hand: einheitliche Wartung, einheitliche Kommunikation, niedrige Stückpreise. Natürlich war das nur möglich, weil der Bund im Rahmen des Digitalpaktes 90 Prozent der Kosten übernommen hat. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der Schuldenbremse verpflichtet, will nach 2024 aber nur noch die Hälfte bezahlen. Der Bremer Standard sei bei einer 50:50-Finanzierung jedoch nicht zu halten, warnt Aulepp.
Der ZEB hatte schon beim Schulbau vorgeschlagen, öffentlich-private Partnerschaften einzugehen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, Bremens Schüler weiterhin mit Tablets auszustatten – und ihre Lehrer mit Smartboards und Beamern in den Klassenräumen. Abgesehen von einem wirtschaftskritischen Ausrutscher in Zusammenhang mit Kita-Öffnungszeiten wirkt Aulepp bemüht, in dieser Wahlperiode linke Haltung zugunsten pragmatischer Lösungen hintanzustellen. Es ist höchste Zeit.