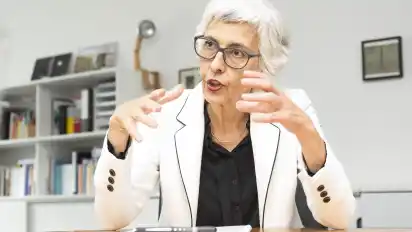Sie haben im Auftrag der Bundesregierung erstmals empirisch erforscht, wie viele Wohnungslose es in Deutschland gibt. Wusste man das bisher nicht?
Jutta Henke: Nein. Bislang gab es nur Daten von Kommunen und einzelnen Bundesländern. Und auf nationaler Ebene hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe regelmäßig mehr oder weniger valide Schätzungen vorgelegt.
Volker Busch-Geertsema: Es gab außerdem einige wenige Zählungen zur Straßenobdachlosigkeit, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und München. Aber die sind einigermaßen unsicher, denn entgegen landläufiger Auffassung sieht man Menschen ihre Wohnungslosigkeit nicht unbedingt sofort an. Umgekehrt ist nicht jeder, der auf der Straße um Geld bettelt oder Flaschen sammelt, zwingend wohnungslos. Das öffentliche Bild von Armut ist eben nicht das Abbild der Wohnungslosigkeit. So kursierten Zahlen von bis zu 800.000 Betroffenen in Deutschland.
Laut einer erstmals vorgenommenen Stichtagserhebung des Statistischen Bundesamtes waren am 31. Januar 2022 in Deutschland rund 178.000 Personen wegen Wohnungslosigkeit untergebracht, beispielsweise in vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten oder in Not- und Gemeinschaftsunterkünften.
Henke: Das ist eine Momentaufnahme von wohnungslosen Menschen, die genau in diesem Moment ein Obdach hatten. Wir haben mit unserer repräsentativen Befragung, Zählung und Hochrechnung vor allem die Zahl derjenigen ermittelt, die nicht von Kommunen oder freien Trägern untergebracht waren. Demnach lebten etwa 37.400 Erwachsene tatsächlich auf der Straße, weitere 49.300 lebten in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit. Hinzu kommen rund 6600 minderjährige Kinder und Jugendliche, die zu mehr als 80 Prozent ebenfalls als verdeckte Wohnungslose gelten können.
Was heißt verdeckte Wohnungslosigkeit?
Henke: Das sind Menschen ohne eigene Wohnung, die aber nicht auf der Straße leben oder in Behelfsunterkünften übernachten. Zumeist haben sie wechselnde Schlafplätze bei Bekannten oder Angehörigen, wo sie aber nicht auf Dauer bleiben können. Oft werden sie als Couch-Surferinnen oder als Sofa-Hopper bezeichnet.
Das funktioniert vermutlich immer nur eine Zeit lang?
Busch-Geertsema: Sicher, aber niemand lebt von jetzt auf gleich auf der Straße. Wer seine Wohnung verliert, macht nicht sofort Platte oder meldet sich bei der nächsten Notunterkunft, sondern mobilisiert erst einmal seine Netzwerke. Je nachdem wie groß diese Ressource ist, kann offene Wohnungslosigkeit manchmal komplett vermieden werden. Es kann häufig bis zu zwei Jahre dauern, bis jemand tatsächlich buchstäblich auf der Straße schläft oder bei den Behörden um Unterkunft bittet.
Wie haben Sie Ihre Zahlen ermittelt?
Busch-Geertsema: Wir sind davon ausgegangen, dass alle Wohnungslosen Spuren in den sozialen Systemen hinterlassen. Wir haben also Institutionen angesprochen, bei denen wir vermutet haben, dass sie Kontakte zu Wohnungslosen haben und diese einfach zählen können. Das sind eben nicht nur die bekannten Anlaufpunkte der Wohnungslosenhilfe, sondern zum Beispiel auch die Tafeln, Beratungsstellen für Schuldner oder Arbeitslose, Anlaufstellen für ehemalige Strafgefangene, Drogenberatungen, sozialpsychiatrische Dienste und viele weitere.
Henke: Entscheidend war, dass wir hier mit einem sehr großen Aufwand solche Stellen in ganz Deutschland recherchiert haben und in Kooperation mit dem in Fragen repräsentativer Politikforschung sehr erfahrenen Münchener Unternehmen Kantar schließlich in 151 Städten daraus eine repräsentative Auswahl treffen konnten. Alle Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern sind darin vollständig berücksichtigt.
Das heißt, Sie haben auch Zahlen aus Bremen?
Henke: Jein. Wir haben eine gemeinsame Stichprobe von zufällig ausgewählten Institutionen aus allen großen Großstädten gebildet und dort wieder zufällig ausgewählte Wohnungslose befragt – auch in Bremen. Hochgerechnet wurde auf Gemeinden der gleichen Größe. Wir können also Großstädte mit Klein- und Mittelstädten vergleichen, aber nicht die Großstädte untereinander.
Busch-Geertsema: Die Großstädte haben zudem auch keine vergleichbaren Verhältnisse. Bremen hat meines Erachtens zum Beispiel ein geringeres Problem als manche anderen Städte gleicher Größenordnung wie Düsseldorf oder Stuttgart, die einen sehr viel angespannteren Wohnungsmarkt haben.
Henke: Wie stark eine Stadtöffentlichkeit Wohnungslosigkeit wahrnimmt, hängt übrigens nicht nur von den Zahlen ab, sondern auch vom politischen Umgang damit. In manchen Städten werden Menschen, die wohnungslos sein könnten, von öffentlichen Plätzen vertrieben. Dann sind sie vielleicht weniger sichtbar, aber trotzdem da.
Was hilft Wohnungslosen?
Busch-Geertsema: Die einfache Antwort lautet Wohnungen. Ganz grundsätzlich liegt die Lösung jedenfalls nicht in der Nothilfe auf der Straße. Es kann ja nicht allein darum gehen, mit Essen und Schlafsäcken die Lebenssituation zu verbessern. Das lindert etwas die akute Not, aber es löst kein Problem.
Henke: Es ist auch wichtig, Wohnungslosigkeit im Vorfeld zu verhindern. Da gibt es zahlreiche ungenutzte Möglichkeiten. Unsere Erhebung hat zum Beispiel ergeben, dass knapp zehn Prozent ihre Wohnung als Folge einer kürzeren Haftstrafe von zum Teil nur einigen Monaten verloren haben. Das sind nach unseren Zahlen also fast 4000 Menschen, die nicht wohnungslos sein müssten. Das Sozialgesetzbuch erlaubt zum Erhalt der Wohnung, dass die Mietzahlungen in solchen Fällen von der Behörde übernommen werden können. Es müsste sich nur jemand darum kümmern, das passiert nicht automatisch. Aber die Betroffenen wissen oft nichts von dieser Möglichkeit. Dass mit dem Antritt einer Haftstraße kein Hartz IV mehr gezahlt wird, ist dagegen ein Automatismus.
Was kann diese erste repräsentative Bestandsaufnahme und Befragung von Wohnungslosen bewirken?
Henke: Wir haben erstmals eine belastbare Zahl und es zeigt sich: Es sind gar nicht so viele Betroffene. Es ist nur ein Prozent der Bevölkerung. Für uns heißt das: Das Ziel, die vorhandene Wohnungslosigkeit praktisch auf Null zu senken und neue ganz zu verhindern, ist gar nicht eine solche Herkulesaufgabe. Das ist mit entsprechendem politischen Willen machbar und absolut realistisch.