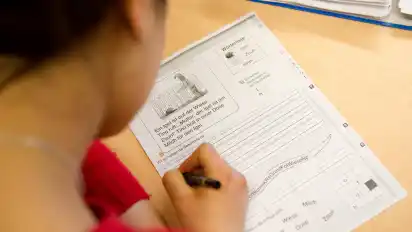Ein substantieller Anteil der Kinder an Schulen im Land Bremen verfehlen in Klasse vier die Mindeststandards im Lesen, Zuhören, Rechtschreiben sowie in Mathematik. Das gilt in vielen Klassenzimmern für mehr als die Hälfte der Kinder, sagt Sabine Doff, Bremer Bildungswissenschaftlerin. Bildungsgerechtigkeit ist der Schlüssel für die Zukunft. Davon ist Sabine Doff überzeugt. Es sei wichtig, jedem Kind das Rüstzeug für ein selbstbestimmtes und reflektiertes Leben mitzugeben.
Deshalb hat die Professorin für Fremdsprachendidaktik Englisch an der Uni Bremen ein Jahr lang wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Praxis gesammelt: Doff besuchte jeweils sechs Schulen in Bremen und in Bremerhaven mehrere Tage lang – auf der Suche nach Lösungen aus der Praxis, die für mehr Bildungsgerechtigekeit sorgen. Ihre Ergebnisse präsentiert sie nicht nur als wissenschafltiche Dokumentation, sondern auch als interaktive Wanderausstellung "Unlock the future" (siehe Info).
"In ihrem Tun sind die Schulen schon sehr weit", lautet das positive Fazit von Sabine Doff. Sie hätten längst eigene Wege beschritten, damit trotz begrenzter finanzieller sowie personeller Ressourcen möglichst kein Kind zurückbleibt. Würden die Schulen nicht so gute Arbeit leisten, wäre es um die Chancengerechtigkeit viel schlechter bestellt, betont die Bildungsforscherin.
"Jede Schule verfolgt ein eigenes Konzept, das sich aus allen drei Formen von Bildungsgerechtigkeit speist", erläutert die Bildungswssenschaftlerin. "Es ist also immer ein Mischkonzept". Bildungsgerechtigkeit habe verschiedene Ebenen: Manchmal müsse der sinnbildliche Kuchen unter allen Kindern gerecht geteilt werden. Manchmal bräuchten auch bestimmte Kinder ein größeres Stück, weil sie sonst selten in seinen Genuss kämen. Wichtig sei auch, die Bedürfnisse der Kinder anzuerkennen: "Alle schauen, was das Kind gerade braucht: Zeit, Berührung oder vielleicht erst einmal einen neuen Schnürsenkel", so Doff.
Schule ohne Gepäck
Ein Beispiel sei das pädagogische Konzept "Schule ohne Gepäck" im gebundenen, also verpflichtenden Ganztagsbetrieb der Neuen Grundschule Lehe in Bremerhaven: Alle Schülerinnen und Schüler finden dort alle Arbeitsmaterialien vor, die sie für ihren Schulalltag brauchen und bekommen außerdem ein Frühstück über den Verein "brotZeit" und warmes Mittagessen. Kein Kind braucht etwas mitzubringen. Das Projekt versucht so, soziale Herkunft und Bildungserfolg voneinander zu entkoppeln. Es ist für eine Erprobungsphase über vier Jahre auf eine zweite Grundschule und zwei Schulen der Sekundarstufe I ausgeweitet worden. Der Magistrat der Seestadt hat die dafür erforderlichen Mittel für die Schulmaterialien bewilligt.
Eine gute Voraussetzung, um alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen und nach dem Prinzip "Demokratie entwickeln" zu beteiligen, ist Doff zufolge eine entscheidungsfreudige und handlungsorientierte Schulleitung, die in Absprache mit dem Kollegium, den Gremien, Eltern und Schülervertretung schnell umsetzt, was machbar ist. Dass die Schülerinnen und Schüler mitenentscheiden können wie an der Neuen Grundschule Lehe, bringe einen hohen Zeitaufwand mit sich.
Berufsbilder direkt in der Schule entdecken
Eine weitere aus ihrer Sicht gelungene Methodik, Bildungsgerechtigkeit zu etablieren, fand Sabine Doff an der Oberschule am Ernst-Reuter-Platz (Bremerhaven): Diese Schule konzentriert sich auf die Berufsorientierung und kooperiert eng mit Firmen unterschiedlicher Branchen. Die Schülerinnen und Schüler lernen diese ab Jahrgang 8 in Berufspraktika kennen.
Ab Jahrgang 9 nehmen die Jugendlichen am jährlich stattfindenden Berufsorientierungstag teil, den die Schule im eigenen Haus ausrichtet. Es gibt Holz- und Metallprojekte, Schmiedeprojekt, Kerzen- und Seifenprojekt (Produktion und Verkauf), Marktstandprojekt und vieles mehr. Der starke Praxisbezug fördere die Entwicklung einer persönlichen Zukunftsperspektive über einen Beruf und die Bereitschaft zum Lernen, so Doff.
"Es ist wichtig, diese Lücke in den Kompetenzen für Kinder in Bremen, die deutschlandweit besonders herausfordernde Startbedingungen haben, zu schließen und ihnen über entsprechende gezielte Zugänge und Förderangebote den Weg in unsere gemeinsame Gesellschaft rechtzeitig zu ebnen", betont sie. "Nur dann können diese Kinder diese Gesellschaft nach demokratischen Werten mitgestalten – nicht vom Rand, sondern aus der Mitte."